Die Krieger
 Was ist ein Söldner?
Was ist ein Söldner?Versuch einer Abgrenzung.
 Die Huren des Krieges
Die Huren des KriegesAnmerkungen zum Söldnerbegriff.
 Die Mietlinge
Die MietlingeSöldner und ihr schlechter Ruf.
 Fahrende Ritter - I
Fahrende Ritter - IAufstieg und Niedergang einer Kriegerschicht.
 Fahrende Ritter - II
Fahrende Ritter - IIVon den Militärtouristen bis zu den Rambos in Bosnien.
 Der Abschaum der Menschheit.
Der Abschaum der Menschheit.Die Rekrutierung von Kriminellen.
Ruhm und Geld
 Raub und Beute - I
Raub und Beute - IVon Anfang an das Hauptmotiv der Krieger.
 Raub und Beute - II
Raub und Beute - IIDer Zivilisationsprozess der Neuzeit.
Riten und Bräuche
 Die Homosexualität
Die HomosexualitätPäderastie und Männerbünde.
 Frauen im Tross
Frauen im TrossMutter Courage und ihre Schwestern.
 Die Hunde des Krieges
Die Hunde des KriegesRituale und Trophäen der Krieger.
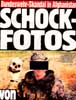 Rituale und Trophäen
Rituale und TrophäenDie schrecklichen Kerle.
Was ist ein Söldner? – Versuch einer Abgrenzung
Auf den ersten Blick erscheint vielen die Frage, was denn genau ein Söldner ist, vielleicht etwas banal. Die UNO benötigte allerdings etwa 20 Jahre, bis sie sich auf einen äußerst müden Kompromiss einigen konnte. Nach endlosen Debatten, die von der Organisation Afrikanischer Staaten (OAS) angestoßen worden war, einigte man sich 1989 dann auf die UN-Konvention "gegen Rekrutierung, Einsatz, Finanzierung und Ausbildung von Söldnern", die dann zur Folge hatte, dass Söldnern im gleichen Jahr durch einen Zusatz zur Genfer Konvention der Status von Kriegsgefangenen abgesprochen wurde. Söldner ist nach dieser Definition, wer nicht zu den Konfliktparteien gehört, nicht offiziell von einem Drittstaat entsandt wurde, speziell für diesen Konflikt geworben und nicht Mitglied einer permanenten Organisation ist. Das heißt durch diese Definition wurden nicht nur die Fremdenlegionen Spaniens und Frankreichs, die Gurkhas und die pakistanischen Regimenter in einigen arabischen Staaten ausgeschlossen, sondern auch alle Militärberater und Instrukteure, wenn ihr Einsatz nur von ihrer Regierung abgesegnet worden war.Natürlich hilft diese Definition niemanden weiter, da sie ja über Söldner so gut wie nichts aussagt, sondern lediglich etwas über die Interessenslage der Unterzeichnerstaaten, die vor allem ihr eigenes Personal ins Trockene bringen wollten. Selbst ein Großteil der berüchtigten Kongosöldner, die ja einer der wesentlichen Auslöser der ganzen Diskussion gewesen waren, wäre nicht unter diese Definition gefallen, da sie ja zumindest offiziell in die Armee Zaires integriert waren. Sogar jemand wie Bob Denard, der heute noch gerne als Paradebeispiel eines Söldners angeführt wird, müsste von jedem UN-Tribunal freigesprochen werden. Schließlich konnte er glaubhaft versichern, immer im Einverständnis mit dem französischen Geheimdienst gehandelt zu haben, und nach seinem letzten großen Coup auf den Komoren nahm er die dortige Staatsbürgerschaft an und konvertierte sogar zum Islam. Betroffen sind eigentlich nur die äußerst finsteren - man könnte auch naiven sagen - Gestalten, die ohne jede politische Rückendeckung für eine Rebellenorganisation in den Krieg ziehen oder sich an einem Staatsstreich beteiligen, mit dem auch wirklich keine Regierung etwas zu tun haben möchte.
Allerdings ging es der UNO nicht um eine allgemeine oder historische Defintion, sondern darum illegale Söldneraktivitäten zu ächten. Sehr eng eingegrenzt werden hier deshalb die Aktionen von Kriminellen definiert, damit sich diese nicht auch noch auf die Rechte normaler Kombattanten berufen können. Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass Militärberater, Fremdenlegionäre oder Angehörige von PMCs nicht als Kriminelle zu betrachten sind. Das Problem ist lediglich, dass sich die UN-Definition vor allem im Internet, wo besonders schnell und gedankenlos kopiert wird, immer weiter verbreitet und dann aus purer Bequemlichkeit als allgemeingültig verkauft wird.
Die UN-Defintion hat sich deshalb weder im Bereich der Geschichtsschreibung noch der aktuellen politischen Literatur durchgesetzt. Auch im allgemeinen Sprachgebrauch wird sie vollständig ignoriert, da Presse und Fernsehen fortwährend von "Söldnern" berichten, wenn es um den Einsatz so genannter PMCs geht. Besonders peinlich ist, dass einige afrikanische Staaten wie der Kongo oder Angola, die sich einst für die Ächtung von Söldnern besonders stark gemacht hatten, inzwischen wieder dankbar deren Dienste in Anspruch genommen haben. Selbst die UN und zahlreiche Hilfsorganisationen sind inzwischen bei Transport, Versorgung, Minenräumung und einer Menge anderer Aufgaben immer stärker auf private Anbieter angewiesen. Man könnte hier also nur noch zwischen "bösen", d.h. illegalen und "guten", d.h. legalen Söldnern unterscheiden. Wobei auch diese Unterscheidung mehr als problematisch ist, da ja die Terroristen von heute bereits morgen als Vetreter ihrer Nation in den UN sitzen können.
Wesentlich einfacher und umfassender sind deshalb die Definitionen in Lexika, die wie z.B. in Webster’s Dictionary ohne politische Rücksichten einen Söldner als "a soldier hired into foreign service" definieren. Doch auch hier stößt man bei genauerer Betrachtung schnell auf einige grundlegende Probleme: was genau soll man unter "hired" verstehen? Lohn ist sicher ein wichtiges Argument, doch versteht man auch "freiwillig" darunter? Wer unterzeichnet den Vertrag und was wird als Lohn geboten? Der Begriff "foreign" ist nicht weniger problematisch, wenn man an Militärberater, Kolonialtruppen oder internationale Freiwillige denkt, oder daran, wie schnell Landesgrenzen geändert oder bei Bedarf Ausländer "nationalisiert" werden. Sehr gut kann man die ganze Problematik im ersten Kapitel von Anthony Mocklers Buch "The Mercenaries" (1970) nachlesen oder in dem Aufsatz von Michael Sikora "Söldner - historische Annäherung an einen Kriegertypus" (2003). Wesentlich schlechter und in vielem zu konstruiert sind dagegen die Definitionsbemühungen von Peter Warren Singer in "Corporate Warriors" (2003).
In diesen - und einigen anderen - Texten geht es letzten Endes um sechs Hauptmerkmale: 1. die Bezahlung, 2. die Freiwilligkeit, 3. die zeitlich begrenzte Tätigkeit, 4. die fremde Nationalität, 5. das Fehlen eines höheren Ziels und 6. die Lust am Krieg als solchem. Gerade die beiden letzten Punkte sollen meistens dazu dienen, Söldner von Kriegsfreiwilligen aus dem Ausland abzugrenzen, wie z. B. den Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg. Wir wollen nun im folgenden diese einzelnen Punkte auf ihre Brauchbarkeit hin überprüfen, um dann nach Möglichkeit zu einer eigenen Definition zu kommen.
1. Die Bezahlung: der Sold, das schnöde Geld ist sicher eines der entscheidenden Kriterien. Man sollte dabei aber bedenken, dass Beute, Landversprechungen sehr oft die Entlohnung in gemünztem Geld ersetzten. Bereits die frühen Hochkulturen rekrutierten Nomaden jenseits ihres Herrschaftsbereichs wahrscheinlich allein mit Beuteversprechen, auch im Mittelalter und noch im 16. Jahrhundert schlossen sich oft große Gruppen den Heeren an, denen außer der Aussicht auf Beute und Lösegelder nichts versprochen wurde. Kaperkriege waren bis zur Französischen Revolution eine äußerst beliebte Methode, mit der sich teure Seekriege allein durch Raub finanzieren ließen. Man sollte aber nicht denken, dass sich diese Praktiken auf längst vergangene Zeiten beschränken. Jean Zumbach erhielt in Katanga und Biafra zwar einen ganz anständigen Sold als Pilot, weit mehr verdiente er aber an den Folgegeschäften als Waffenhändler. Einige moderne PMCs bieten ihre Dienste praktisch gratis an, um dann anschließend die Rohstoffe ihrer Kunden ganz legal auszuplündern. Und mancher Warlord im Goldenen Dreieck und in Afghanistan erhielt für den Einsatz seiner Krieger wahrscheinlich nur die höchst geheime Zusicherung, künftig das in der Region angebaute Opium allein vertreiben zu dürfen.
Ähnlich verhält es sich mit den Landversprechungen. In der Antike gab es die so genannten Kleruchen, Militärkolonisten, denen für ihre Dienste Land überlassen wurde. Die ägyptischen Pharaonen siedelten tausende griechischer Söldner als Kleruchen im Nildelta an und auch der persische Großkönig und seine Satrapen machten davon reichlich Gebrauch. Im Mittelalter war Land dann lange das Hauptzahlungsmittel. So waren die ersten Normannen zwar im Sold langobardischer Fürsten nach Süditalien gekommen, als das Geld dann nicht reichte, nahmen sie nur allzu gerne Land als Ersatz. Auch der Hundertjährige Krieg wurde zumindest von den englischen Königen teilweise durch große Landversprechungen in Frankreich finanziert. Wallenstein hat, als seine enormen Heere vom Kaiser nicht mehr finanziert werden konnten, als Ausgleich ganze Fürstentümer in Zahlung genommen. Noch im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg warben die Amerikaner Überläufer mit Landschenkungen, wovon sie ja genug hatten. Aber auch im 19. Jahrhundert wurden vor allem in Lateinamerika aber auch in Südafrika und Neuseeland Söldner noch teilweise mit Land bezahlt. Auch wenn die Aussicht auf eine eigene Farm heute kaum noch jemanden reizt in den Krieg zu ziehen, so erfüllen doch die von einigen Ländern in Aussicht gestellten Bürgerrechte eine vergleichbare Funktion.
2. Die Freiwilligkeit: Ganz im Gegensatz zum Kriterium der Bezahlung, das unseres Erachtens nach nur etwas erweitert und differenziert werden muss, handelt es sich bei der Freiwilligkeit um einen fatalen Irrtum, der nur durch eine allzu starke Fixierung auf die neuere abendländische Geschichte und eine Überdosis Machiavelli zu erklären ist. Natürlich wurden für den Solddienst gerne Freiwillige geworben. Wenn der Bedarf aber das Angebot überstieg, wurde regelmäßig auf Zwang zurückgegriffen - und wir reden hier nicht davon, dass man die potentiellen Rekruten betrunken machte und ihnen goldene Berge versprach. So ist die Verwendung von Kriegsgefangenen, die ja Sklavenstatus hatten, oder der gezielte Ankauf von Sklaven zum Kriegsdienst seit der Antike eine weit verbreitete Praxis. Bereits Assyrer und Ägypter kamen auf diese Weise mit zu ihren besten Soldaten. Die skythischen Bogenschützen, lange die einzige stehende Truppe der freiheitsliebenden Athener, wurden zum Großteil auf dem Sklavenmarkt gekauft. Im Mittelalter unterhielten vor allem islamische Staaten Elitetruppen aus türkischen, slawischen, europäischen und afrikanischen Sklaven. Das christliche Abendland wurde von dieser Praxis wahrscheinlich nur abgehalten, da hier niemand die finanziellen Mittel hatte, ein stehendes Heer zu unterhalten; wenn aber Not am Mann war, leerte man zumindest die Gefängnisse.
Als in Europa dann ab etwa Mitte des 17. Jahrhunderts genug Geld zur Finanzierung stehender Truppen vorhanden war, näherten sich die Praktiken des Soldatenhandels sehr schnell denen des Sklavenhandels. Es ist uns ein Rätsel, wieso gerade die Epoche des Absolutismus, die als Höhepunkt bei der Verwendung von Söldnern gilt - fast alle europäischen Armeen hatten einen Ausländeranteil von 20-30% -, bei der Definition des Begriffs völlig ignoriert wird - lediglich Sikora verweist kurz auf diese Problematik. Das ist um so erstaunlicher, da bei allen Historikern, die sich mit dieser Zeit beschäftigen, völlige Klarheit über die Bedeutung von Söldnertruppen und die damit untrennbar verbundene Unterdrückung herrscht. Die zum Großteil durch Zwang aufgebrachten Truppen wurden gegen gutes Geld vermietet oder ganz verkauft. Der so genannte Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I. kaufte seine geliebten "Langen Kerls" in halb Europa zusammen oder ließ sie von spezialisierten Menschenjägern rauben. Für das berühmte Bernsteinzimmer erhielt er vom Zaren 55 besonders groß gewachsene Russen und für die "Dragonervasen" aus Sachsen 600 Dragoner. Aber auch die "Pressgangs" der britischen Marine waren gefürchtet. Bei Bedarf stoppten die Schiffe seiner Majestät auf offener See fremde Handelsschiffe und rekrutierten einfach einen Teil der Besatzungen; tausende Ausländer dienten auf diese Weise unter britischen Fahnen.
Erst im Gefolge der Französischen Revolution und der allgemeinen Wehrpflicht kam diese Praxis in Europa zwar in Verruf (man hatte ja nun genug Menschenmaterial, das noch billiger war), verschwand damit aber noch lange nicht von der Bildfläche. So lockte man in den 1820er Jahren deutsche und irische Immigranten nach Brasilien, um sie dann zum Kriegsdienst zu pressen. Auch die Nordstaaten bedienten sich während des Sezessionskrieges ähnlicher Methoden. Obwohl in Europa im Laufe des 19. Jahrhunderts auf das Pressen von Ausländern verzichtet wurde, feierte es bei der Eroberung Afrikas neue Triumphe. Man kann natürlich der Ansicht sein, dass die Europäer nach der Aufteilung des Kontinents als neue Herren ein Anrecht auf die Dienstpflicht der Einheimischen hatten - wir sind es allerdings nicht. Gerade in der Anfangszeit besorgten sich die Ägypter und Briten im Sudan, die Force Publique im Kongo oder die Franzosen in Westafrika einen guten Teil ihrer Soldaten auf dem Sklavenmarkt und ergänzten ihre Truppen mit denen geschlagener Kriegsherren.
Auch das 20. Jahrhundert brachte trotz des patriotischen Rummels nur wenig Änderungen. Man hat sogar den Eindruck, dass durch das laute Geschrei so manches verdeckt werden sollte. So ist es auffallend, dass gerade die Nazis, die den kranken Kult um Opfertod und Vaterland ja am aufwendigsten zelebrierten, zigtausende Russen für ihre Ostlegionen rekrutierten. Nun mögen unter diesen armen Teufeln tatsächlich einige von dem Wunsch gegen den Kommunismus zu kämpfen erfüllt gewesen sein, für die große Masse aber war es nur ein Ausweg dem sicheren Hungertod zu entkommen. Wer meint, dass diese Praktiken endlich auf der Müllhalde der Geschichte gelandet seien, muss nur nach Afrika oder Kolumbien schauen, um sich eines Besseren belehren zu lassen. Dort werden bei Bedarf Gruppen von Kindersoldaten verschachert oder in die Reihen der Sieger eingegliedert.
3. Die zeitlich begrenzte Tätigkeit: ähnlich wie mit der Freiwilligkeit verhält es sich mit der zeitlichen Begrenztheit von Söldnerdiensten. Auch sie ist ein völliger Irrtum aus einer modernen eurozentristischen Perspektive. Selbstverständlich waren die Dienstverhältnisse oft sehr eng begrenzt - im Mittelalter möglichst auf die wenigen Wochen eines Feldzuges -, da niemand ein großes Söldnerheer lange finanzieren wollte und auch nicht konnte. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den Leibgarden, die dauerhaft unterhalten wurden. Die Germanen der julisch-claudischen Kaiser, die Waräger in Byzanz oder die Schotten und Schweizer in Frankreich dienten oft ihr ganzes Arbeitsleben in derselben Einheit. Und nicht nur das; manchmal wurden diese Posten über mehrere Generationen in einer Familie weiter gegeben - Söldner waren es trotzdem. Als der Ausbau der staatlichen Strukturen und Finanzen dann den Unterhalt stehender Heere erlaubten, war es mit der begrenzten Dienstzeit sehr schnell vorbei. Gefragt wurden die Söldner dabei nicht, meistens wurden ihre Verträge willkürlich verlängert.
Das leider weit verbreitete Märchen von der zeitlich begrenzten Tätigkeit sagt lediglich etwas über die finanziellen Verhältnisse der Auftraggeber aus aber absolut nichts über die Einstellung der Söldner. In Zeiten, in denen zumindest für gute Truppen ein relativ anständiger Sold bezahlt wurde (d.h. etwas mehr als der Lohn eines Handwerkers), wollten Söldner meistens dienen und nahmen ihre Entlassung nur widerwillig hin. Dann brachten sie sich bei ihren Familien oder bettelnd manchmal auch mit Straßenraub mehr schlecht als recht über den Winter, um dann bei der nächsten Gelegenheit wieder unter der selben Fahne anzumustern. Sie glichen also mehr Saisonarbeitern, die sich mit diesen Verhältnissen abfinden mussten. Wer in den wenigen permanent besoldeten Truppen unterkommen konnte, gehörte zu den Privilegierten. Im Absolutismus war der Sold dann so weit gesunken, dass viele versuchten ihrem erbärmlichen Schicksal zu entfliehen, doch da richteten sich die Hauptanstrengungen der Obrigkeit bereits gegen die Verhinderung der Desertionen. Entlassen wurden dann nur noch alte Männer und Invaliden.
4. Die fremde Nationalität: Über das Kriterium, dass es sich bei Söldnern um Ausländer handelt, herrscht weitgehend Einigkeit. Für einige Autoren wie z. B. Janice Thomson ist es sogar das einzig gültige. Dennoch ist auch diese Sache nicht ganz so einfach. Nimmt man z.B. die Zeit der immer wieder angeführten Condottieri im Italien der Renaissance, so stößt man schnell auf die Tatsache, dass fast alle Italiener waren. Es wäre nun sicher nicht korrekt, in einem Truppenverband, der aus den Diensten von Florenz in die von Mailand gewechselt war, die Mailänder nicht als Söldner zu bezeichnen, die Florentiner dagegen erst nach dem Wechsel. Ähnlich verhält es sich mit dem Dreißigjährigen Krieg. Sind in Wallensteins Armee nur richtige Ausländer Söldner, oder nur Protestanten, ein guter Katholik dagegen nicht? Was ist mit den Chinesen, die sich von der "Ever Victorious Army" für den Krieg in China anwerben ließen, oder mit den Meo-Stämmen, die von der CIA für ihren heimlichen Krieg in Laos rekrutiert wurden? Gerade die aktuelle Weltlage zeigt eine starke Tendenz zum Zerfall von Staaten, Bürgerkriegen und der Mobilisierung ethnischer und religiöser Minderheiten im Interesse auswärtiger Mächte. Man sollte es sich also nicht so einfach machen.
Kompliziert wird diese Fragestellung noch dadurch, dass Söldner eben oft keiner zeitlich begrenzten Tätigkeit nachgehen, sondern dauerhaft bleiben. Die Söldnergeschichte ist voller Beispiele von Immigranten und Flüchtlingen, die freiwillig ihre Dienste anboten oder denen keine andere Wahl blieb. Viele Germanenstämme waren so ins römische Reich gekommen, die Türken nach Kleinasien. Zahlreiche schottische, schweizer, irische und viele andere Söldner wurden auf diese Weise zu guten Franzosen. Die USA verwendeten Exilkubaner im Kongo und südafrikanische PMCs warben einen guten Teil ihres Personals unter Emigranten aus Angola, die dort für Südafrika gekämpft hatten und nun ein recht erbärmliches Dasein im Exil fristen. Heute ist es in einigen westlichen Staaten eine beliebte Methode geworden, die fehlenden Rekruten mit Einwanderern zu ergänzen - Tendenz steigend! Ab wann ist also ein Immigrant kein Ausländer mehr? Sicher nicht ab dem Zeitpunkt, an dem er einen neuen Pass erhält. Denn diese Papiere werden bei Bedarf schon bei der Einreise ausgegeben.
5. Das Fehlen eines höheren Ziels: Vor allem mit diesem Argument wird ein fundamentaler Gegensatz zwischen materialistischen (finsteren) Söldnern und hehren Patrioten oder Idealisten, die für eine gerechte Sache in den Krieg ziehen, konstruiert. Nun sollte man aber nicht ganz vergessen, dass die ganz großen Schweinereien in der Geschichte fast immer in Namen eines Gottes, eines Vaterlandes oder einer anderen höheren Sache verübt worden sind. Das eigentliche Problem ist aber, dass auch Söldner am liebsten für höhere Ziele kämpfen. So findet man die protestantischen Schotten im Dreißigjährigen Krieg vor allem auf schwedischer Seite, die katholischen Iren später bevorzugt in französischen oder habsburgischen Diensten. Man kann sehr oft beobachten, dass Söldner, die sich irgendwo in der Welt schlagen, beim Ausbruch eines Krieges in ihrem Vaterland, erleichtert zu den heimischen Fahnen eilen. Aber auch in dem Interview mit Kongo-Müller kann man - wenn man will - einen echten Idealisten auf seinem Kreuzzug gegen den Kommunismus erkennen. Natürlich sei er gerne beim Aufbau einer "Legion Vietnam" oder der "Befreiung der DDR" behilflich, betont er durchaus glaubhaft. Manche der alten Veteranen von Executive Outcomes sollen Tränen in den Augen gehabt haben, als sie von der Bevölkerung Sierra Leones als Befreier bejubelt wurden. Bei ihrem früheren Dienst fürs Vaterland (das Apartheid-Regime von Südafrika) waren sie stets als Rassisten beschimpft worden. Wenn sie die Möglichkeit haben, wählen Söldner ihren Arbeitgeber durchaus unter ideologischen Gesichtspunkten aus. Es ist kein Zufall, dass viele eher rechtsgerichtete Europäer im Jugoslawienkrieg unter kroatischer Fahne kämpften, ihre russischen Kollegen dagegen auf serbischer Seite.
Für echte Berufssoldaten war es schon immer wesentlich einfacher, ihr Handwerk im Namen ihres Königs oder ihres Vaterlandes auszuüben. Da konnten sie auf bestehende Beziehungen vertrauen, ihr Besitz kam nicht in Gefahr und im Alter konnten sie vielleicht sogar mit einer Pension oder ähnlichem rechnen. Für viele entstanden die Probleme erst, wenn in der Heimat keine Soldaten gebraucht wurden, oder sie sich beim Garnisonsdienst zu Tode langweilten. Vor allem diejenigen, die ohne Zwang und materielle Not in fremde Kriege zogen, folgten dabei sehr oft ideologischen Vorlieben. Ihnen fehlten also nicht die Ideale, sondern lediglich die Möglichkeit diese in der Heimat auszuleben. Der Bürgerkrieg in Jugoslawien zog viele Freiwillige aus Westeuropa an, die auf eigene Kosten anreisten und dann oft weniger Sold erhielten als das, was sie zu Hause an Sozialhilfe bekommen hätten. Es kann ihnen also kaum ums Geld gegangen sein.
6. Die Lust am Krieg: Ganz besonders in diesen "Fahrenden Rittern", die oft eher Kampf, Abenteuer und Ehre (was auch immer sie darunter verstehen mögen) suchen als Geld, sehen viele den Idealtypus des Söldners. Mockler unterstellt ihnen "a devotion to War for its own sake". Singer schreibt: "they simply harbor an open commitment to war as a professional way of life." Und sicher lassen sich dafür in der Söldnergeschichte zahllose Belege finden. Wenn ein Häuptling bei keltischen oder germanischen Stämmen Krieger für ein Söldnerkontingent sammelte, spielte Abenteuerlust sicher eine mindestens ebenso wichtige Rolle wie die Aussicht auf materiellen Gewinn. Im Mittelalter wird diese Einstellung so programmatisch für den Adel, dass man schon nach den materiellen Motiven dahinter suchen muss. Man kann aber auch an die süddeutschen Bürgersöhne denken, die sich von den niederländischen Handelsgesellschaften anwerben ließen, um endlich einmal ferne Länder zu sehen. Das 19. Jahrhundert ist voll verkrachter und gelangweilter Offiziere, die in verschiedenen Revolutionen und Kolonialkriegen zwar auch manchmal ihr Auskommen vor allen Dingen aber Abenteuer und Abwechslung suchen. Oft sind es die Jungen, die nach einem Krieg mit den Erzählungen ihrer Väter aufwachsen und nun selbst etwas erleben wollen. "Wir haben das aufgesogen wie Schwämm", erzählt ein Fremdenlegionär der Nachkriegsgeneration, der in Indochina diente. Der Brite Peter McAleese erzählt, wie es ihm als Fallschirmjäger auf die Nerven ging, dass die Alten ständig von Arnheim erzählten. Schließlich wurde er Söldner, da ihm die britische Armee nicht genug Action zu bieten hatte.
Es gibt zahlreiche Studien über die Traumatisierung von Vietnamveteranen. Das hält aber viele junge Rekruten der US-Army nicht davon ab, gerade den Vietnamkrieg romantisch zu verklären und ihn als "verpasste Chance" zu betrachten. Sicher gehen viele zur Armee, um ihrem Land zu dienen, einen sicheren Job zu haben oder eine Ausbildung zu bekommen. Aber nicht wenige wollen vor allem etwas erleben. Moderne Armeen machen sich dieses Bedürfnis zu Nutze und werben deshalb nicht nur mit materiellen Anreizen (Bezahlung Ausbildung, Papiere, sicherer Job), sondern appellieren gezielt an die Abenteuerlust potentieller Rekruten. Die Lust am Krieg ist also etwas, das man auch unter Berufssoldaten und idealistischen Freiwilligen finden kann.
Man sollte sich aber bei "Krieg" nicht allein auf Kampf und Töten konzentrieren. Ganz zentral geht es um "soldatische Werte": die Zugehörigkeit zu einer verschworenen Gemeinschaft, Kameradschaft, Treue, Tapferkeit, Anerkennung aus der Gruppe. Manche mögen dies für reaktionär oder gar lächerlich halten, dennoch sind es Gedanken, die Männer (manchmal auch Frauen) umtreiben und die man deshalb nicht einfach ignorieren oder mit ein paar Schlagworten abtun sollte. Ein Gurkhaoffizier sagte in den 70er Jahren: "Every man in this world wants to be brave and woulds like other people to call him brave. The army is the easiest way by which one can demonstrate one’s braveness to the world. It is this that makes men enlist in the Army".
Die genauere Betrachtung der verschiedenen Kriterien verdeutlicht, dass sicher einige Punkte auf Söldner zutreffen können, aber nicht müssen. Sehr oft demonstrieren sie nur deren Nähe zu anderen Formen des Kriegertums, wie Berufssoldaten, Abenteurern, ausländischen Freiwilligen und unterstreichen dadurch das Problem der Abgrenzung. Es ist deshalb wahrscheinlich besser frei nach Sartre eine Sache dadurch zu definieren, was sie nicht ist. Einen absoluten Gegenpol zu jeder Art von Söldnertum findet man in allen Zivilisten, die nur in Zeiten der Not, wenn ihre direkte Umgebung, ihre Heimat, ihr Haus, ihre Familie bedroht werden, zur Waffe greifen. Sie kämpfen dann vorwiegend defensiv und zeitlich äußerst begrenzt in Volksaufgeboten und Milizen. Natürlich ist auch das nicht immer ganz freiwillig. Die Gruppe erwartet aus gutem Grund, dass sich alle der Gemeinschaft gleichermaßen an den Lasten und den Risiken des Kampfes beteiligen. Gegen Unwillige, die sich dem zu entziehen versuchen, wird deshalb oft mit aller Härte vorgegangen. Fast immer ist die Zugehörigkeit zu einer Gruppe - z.B. das Bürgerrecht - mit der Pflicht, sich an der Verteidigung zu beteiligen fest verbunden. Deshalb wird normalerweise auch keine Art von Sold bezahlt. Oft müssen sich die Kombattanten sogar selbst ausrüsten und verpflegen. Man findet diese Art des Kriegsdienstes in den meisten bäuerlichen Gesellschaften, in den Stadtstaaten der Griechen, den mittelalterlichen Städten und letzten Endes auch abgewandelt in der allgemeinen Wehrpflicht moderner Staaten. Alles, was sich auf die eine oder andere Weise von diesen Aufgeboten entfernt, nähert sich bereits mehr oder weniger dem Söldnertum an.
Diese Problematik lässt sich bereits bei barbarischen Stämmen wie Kelten, Germanen oder nordamerikanischen Indianern beobachten. Zur Verteidigung der Heimat waren alle verpflichtet - vom Jügling bis zum Greis. An den Kriegs- und Raubzügen in die Fremde dagegen beteiligten sich Freiwillige, die sich davon Beute, Trophäen, Sold, Abenteuer oder nur Ruhm und Ehre versprachen. Ob eine benachbarte Großmacht mit Geschenken und Beuteversprechen zu einem solchen Kriegszug motiviert oder ob man nur Vieh auf eigene Faust rauben möchte, ändert daran wenig. Imperiale Mächte wie die Römer und später die Briten, die konstant fern der Heimat Kriege führten, konnten das nie mit Wehrpflichtigen tun, sondern mussten dazu Berufssoldaten einsetzen, die dann zunehmend durch Södner verstärkt manchmal sogar weitgehend ersetzt wurden. Selbst im Feudalismus, wo ja eine Schicht professioneller Krieger zur Verfügung stand, waren Kaiser und Könige bald gezwungen bei auswärtigen Kriegen Sold zu bezahlen, da die Lehnsfolge räumlich und zeitlich sehr begrenzt war. Auf diese Weise wandelte sich der Lehensdienst zum Söldnertum, und das meist so schnell, wie es die bescheidenen Finanzen erlaubten.
Möchte man nun Söldner im Gegensatz zu Milizionären definieren, so kann man sagen: Ein Söldner kämpft für eine Sache, die ihn eigentlich nichts angeht, d.h. für ihn ließe sich auch unter weit gespannten Kriterien keine Art von Dienstpflicht konstruieren. Wir sagen "eigentlich", da sich in der Regel meisten eine Art Identifikation entwickelt, sofern diese nicht schon vorher bestanden hatte. Deshalb handelt es sich bei Söldnern trotz aller Problematik um "Ausländer", besser gesagt um "Fremde", worunter natürlich unter gewissen Umständen auch die Einwohner der nächsten Stadt zu verstehen wären. Im Gegensatz zu Milizionären werden Söldner auf irgendeine Weise entlohnt, da sie als Profis von diesem Einkommen leben müssen.
Wenn also ein Ausländer für eine Sache kämpft, an die er so stark glaubt, dass er bereit ist sein Leben für sie hinzugeben, so könnte man auch sagen, dass für ihn zumindest eine hypothetische Dienstpflicht besteht; es sich also nicht um einen Söldner handelt. Das war sicher zu Zeiten der Kreuzzüge bei vielen der Fall, aber auch bei den Glaubenskriegern von der anderen Seite. Auch wenn ein überzeugter Kommunist in den Internationalen Brigaden kämpfte, war er wahrscheinlich der Überzeugung, einer höheren Pflicht Folge zu leisten. Ähnliches muss man dann aber auch für die europäischen Freiwilligen der Waffen-SS gelten lassen. Bei denjenigen, die sich Hitlers Ostlegionen "nur" anschlossen, um nicht zu verhungern, ist die Sache dann schon nicht mehr so einfach. Wir würden am liebsten all diese Idealisten und Fanatiker, die unbedingt für ein höheres Ziel sterben wollen, vollständig ignorieren. Das Problem ist nur, dass sie immer wieder gerne für Söldnerdienste missbraucht wurden, oder dass sie selbst, nachdem ihre Ideale erst einmal zerbrochen waren, ihre Tätigkeit für Geld ausübten. Eines der übelsten Beispiele ist hier sicher das Schicksal der Polnischen Legion auf Haiti. Sogar die Französische Fremdenlegion wurde vor allem deshalb gegründet um politische Flüchtlinge zu "entsorgen", und in fast allen Söldnerformationen des späten 19. Jahrhunderts stößt man auf gescheiterte 48er Revolutionäre. Noch in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts leisteten geflohene deutsche Terroristen von der Roten Armee Fraktion und solche von der Wehrsportgruppe Hoffmann Söldnerdienste für die PLO im Libanon.
All diejenigen, die zwar auch für eine gute Sache kämpfen wollen, bei denen aber die Abenteuerlust im Vordergrund steht und die tatsächlich keine materiellen Vorteile im Auge haben, bezeichnen wir als "Fahrende Ritter", um das historisch unzeitgemäße zu unterstreichen. Die Unterscheidung von den reinen Idealisten ist natürlich schwierig, da man über die Motivation des Einzelnen nur schlecht urteilen kann. Oft erkennt man sie aber daran, dass sie alleine reisen und auch gerne den Schauplatz wechseln, wenn die Sache zu langweilig wird. Auch wenn sie oft von "höheren Zielen" reden, so bekommt man doch leicht den Eindruck, dass sie eine Art Abenteuerurlaub machen. Von den typischen Söldnern unterscheiden sie sich schon deshalb, da sie es sich leisten können, auf den Sold zu verzichten und deshalb in ihren Wahlmöglichkeiten wesentlich freier sind. Dennoch findet man diesen Typus in fast allen Söldnerformationen, und sehr oft, wenn ihm das Geld ausgeht, verrichtet er seinen Dienst wie alle anderen auch.
Treten bei einem Fahrenden Ritter materielle Interessen in den Vordergrund, spricht man gerne von einem "soldier of fortune", was man im Deutschen mehr schlecht als recht mit "Glücksritter" übersetzen könnte. Der Begriff kommt aus dem romanischen Sprachraum, wo man lange alle fremden Söldner als "aventuriers/aventureros" oder "soldati di fortuna/soldats de fortune" bezeichnete. Im Englischen verwendete man häufiger die Bezeichnung "Free Lance", was heute völlig auf den zivilen Bereich übergegangen ist. Alle diese Begriffe unterstreichen die Unabhängigkeit dieser Krieger. Im Gegensatz zum einfachen Fußvolk suchen sie sich ihre Arbeitgeber meistens relativ frei und erwarten auch nicht immer pünktliche Bezahlung. Sie haben Größeres vor: eine gut dotierte Offiziersstelle, ein Ministeramt, Handelsprivilegien und immer wieder Land, nach Möglichkeit ein eigenes Reich. Kipling hat diesen Typus in seinem Roman "Der Mann, der König sein wollte" am besten beschrieben.
Völlig fließend ist die Unterscheidung zwischen Söldnern und Berufssoldaten. Das liegt schon allein daran, dass die historische Entwicklung vom Volksaufgebot zum Söldnerheer meistens über diesen Weg verläuft. Sobald eine Gesellschaft komplexer wird, kommt sie zwangsläufig zu der Einsicht, dass es für viele besser ist, den zivilen Geschäften nachzugehen und das Kämpfen einigen Spezialisten zu überlassen, die dafür bezahlt werden. Daran ist sicher nichts auszusetzen, so lange diese Berufskrieger, den selben sozialen Schichten entstammen wie die Entscheidungsträger. Irgendwann kommt dann aber der Punkt, an dem die Soldaten für ihre harte und gefährliche Arbeit nur noch miserabel bezahlt werden. Dann geht man dazu über den Nachschub fast ausschließlich unter den sozial Schwachen zu rekrutieren. So war und ist es auch heute noch in vielen Ländern mit "Wehrpflicht" möglich, sich von diesem unbequemen Dienst freizukaufen. "Rich man’s war, poor man’s fight", war ein berühmter Slogan im amerikanischen Bürgerkrieg. Man befindet sich in diesem Fall bereits auf einer Vorstufe zum Söldnertum. Der nächste Schritt kommt dann, wenn es auch den Unterschichten so gut geht, dass man unter ihnen nicht mehr genug Freiwillige findet und sie politisch so einflussreich sind, dass man sie nicht mehr zwingen kann. Dann geht man notgedrungen dazu über die Lücken mit Ausländern zu füllen.
Aber auch die einheimischen Berufssoldaten nähern sich manchmal dem Söldnertum an, und zwar dann, wenn materieller Gewinn und Abenteuerlust immer stärker in den Vordergrund rücken. Absolut keine Probleme gibt es, wenn der bezahlte Profi mit der aufgebotenen Miliz bei der Verteidigung seines Landes kämpft. Schwieriger wird es schon, wenn er in fremde Länder geschickt wird, um dort mitunter äußerst dubiose Interessen durchzusetzen. Sehr oft erwarten Berufssoldaten dann mit Recht, dass sie an den erwarteten Gewinnen, durch höheren Sold oder Beute beteiligt werden. Bereits im Mittelalter war die Dienstzeit der Ritter zeitlich auf 4 bis 6 Wochen begrenzt und Einsätze in Übersee waren oft ausdrücklich davon ausgenommen. Wollte ein Herrscher also seine Lehnsleute zu einem solchen Kriegszug gewinnen, musste er Sold bezahlen oder andere Dinge wie Land und Beute in Aussicht stellen. In einem Großteil der Fachliteratur werden deshalb die englischen Truppen während des Hundertjährigen Krieges durchweg als Söldner bezeichnet.
Dieser Trend verstärkt sich während der kolonialen Expansion. Natürlich sprachen auch hier alle vom Dienst an König und Vaterland; letzten Endes aber ging man in die Kolonien, um sein Glück zu machen, um reich zu werden. Nationale Aufgebote hätte man kaum dahin schicken können. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass im 19. Jahrhundert, als in Europa kaum noch Söldner verwendet wurden, diese in den Kolonien ein letztes Refugium fanden. Gleichzeitig nahm die Verwendung einheimischer Kolonialtruppen - ein preiswerter Ersatz europäischer Söldner - immer größere Ausmaße an.
Wir wollen nicht behaupten, dass es sich bei Berufssoldaten, die in Übersee dienen, um richtige Söldner handelt. Schließlich gelten die spanischen Konquistadoren und ihre französischen und englischen Nachfolger als nationale Heroen. Dennoch möchten wir auf den engen Zusammenhang verweisen. Außerdem war gerade der Kolonialdienst einer der letzten größeren Söldnerproduzenten neuerer Zeit. Viele der Söldner der 60er und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hatten ihr Handwerk in den Kolonialkriegen Frankreichs und Großbritanniens gelernt. Auch von denen, die heute aus der Ex-Sowjetunion und den USA auf den Markt kommen, haben die allermeisten vorher als Berufssoldaten im Ausland gedient. Noch einen Schritt näher am Söldnertum stehen Militärberater, die zwar meist auch irgendwie mit der Erlaubnis ihrer Regierung arbeiten, vorwiegend aber den Interessen der Rüstungsindustrie dienen. Für sie besteht keinerlei Dienstpflicht; sie erledigen ihren Job gegen gute Bezahlung und zum Teil sicher auch aus Abenteuerlust.
Bei "Kriegsreisende" werden wir uns mit denjenigen beschäftigen, die in fremde Kriege gezogen sind. Ob sie dies freiwillig, aus Leichtsinn oder aus Zwang taten, ist dabei für uns genau so irrelevant wie die Frage, ob sie hauptsächlich Geld, Land oder Ruhm und Abenteurer erwarteten. Nur die wirklich überzeugten Kreuzritter und anderen Menschheitserlöser werden wir weitgehend beiseite lassen, und uns nur dann mit ihnen beschäftigen, wenn sie etwas von ihren tugendhaften Pfaden abwichen. Vor allem wollen wir uns aber nicht auf einen Idealtypus konzentrieren, sondern möglichst viele der unzähligen Facetten, Grauzonen und Widersprüche des Gewerbes aufzeigen. Denn letzten Endes werden ja Begriffe nur im Vergleich und im Kontrast deutlich. Unsere Leser mögen dann selbst entscheiden, wen sie für einen echten Söldner halten, wen für einen gescheiterten Idealisten und wen für ein bedauernswertes Opfer der Umstände.
Literatur zum Söldnerbegriff:
Mockler, Anthony
The Mercenaries; 1970
Thomson, Janice
Mercenaries, Pirates, and Sovereigns; 1994
Singer, Peter Warren
Corporate Warriors; 2003
Sikora, Michael
Söldner - historische Annäherung an einen Kriegertypus; 2003
