Der Dreieckshandel
Im Merkantilismus zeigten sich auffallende Parallelen zwischen Soldaten- und Sklavenhandel.
Hatte sich die soziale Situation der Söldner seit dem Ende des 16.
Jahrhunderts bereits stetig verschlechtert, so wurde sie seit Kapitalismus
und Merkantilismus immer stärker die Politik und damit auch die
Kriege bestimmten geardezu katastrophal. Söldner wurden zu einer Ware,
die rücksichtslos verschachert und verschlissen wurde. Der anarchische
Freiheitswillen der Landsknechte und ihr gockelhafter Stolz wurde
vom Absolutismus, der Macht des Geldes und den Korporalstöcken
endgültig zerbrochen. Söldner waren der Auswurf der
Gesellschaft, der einem sinnvollen Zweck zugeführt werden sollte.
So befahl ein fürstlicher Erlass in Hessen, dass "die Beamten das sich
einschleichende herren und nahrungslose Gesindel wie auch Müßiggänger,
so nichts zu verlieren haben und zum Soldaten tüchtig, unter
Anerbietung eines gewissen Anreitzgeldes anzuwerben sich bemühen sollen".
In ganz Europa stellten entlassene Söldner und Deserteure den größten
Anteil der zahlreichen Räuberbanden. Andererseits wurden Häftlinge
oft wieder den Werbern übergeben. Jeder sollte arbeiten und den Reichtum
seines Fürsten mehren, und wer dazu nicht taugte sollte als Soldat Nutzen
bringen. Der Soldatenhandel brachte diese Einstellung deutlich zum Ausdruck.
Aber auch die, die nicht von ihren Fürsten verkauft wurden, die immer
noch auf eigene Faust unterwegs waren, verfingen sich im Netz des Merkantilismus.
Während die Fürstenpaläste mit den Gewinnen der Handelsgesellschaften
um die Wette wuchsen, wurde der Kriegsdienst zu einem immer schäbigeren
Geschäft. Am schlimmsten waren die Auswüchse, wo es mit dem Sklavenhandel
direkt in Berührung kam und die Parallelen nicht mehr zu übersehen sind.
 Auf der Suche nach schnellen Gewinnen war der sogenannte "Dreieckshandel"
entstanden. Man tauschte an der afrikanischen Küste europäische
Manufakturenwaren (Werkzeuge, Waffen, Textilien, Glas etc.) gegen Sklaven,
transportierte diese nach Westindien, wo man für sie Zucker, Tabak und
Gewürze erhielt, die sich dann wieder in Europa mit großem Profit
verkaufen ließen. Ein Sklave, den man in Afrika für Branntwein
und minderwertige Tauschartikel im Wert von 5 Gulden erwerben konnte, brachte
in Südamerika gut das Zehnfache in Zucker, der in Europa wiederum für
ein Vielfaches verkauft werden konnte. Die Aktien, der im Dreieckshandel
tätigen Gesellschaften, warfen riesige Gewinne ab. Geschickte und skrupellose
Kaufleute wie zum Beispiel die Schimmelpfennigs errichteten sich Schlösser,
erwarben weite Ländereien und wurden in den Adelsstand erhoben. Da wollten
auch die Fürsten nicht hintanstehen und beteiligten sich oder gründeten
eigene Gesellschaften. Doch mit dem Wachstum des Geschäfts und der zunehmenden
Konkurrenz benötigten die Gesellschaften feste Stützpunkte in Afrika,
in denen die Sklaven gesammelt werden konnten, und eigene Plantagen, wo man sie
sicher absetzen konnte.
Auf der Suche nach schnellen Gewinnen war der sogenannte "Dreieckshandel"
entstanden. Man tauschte an der afrikanischen Küste europäische
Manufakturenwaren (Werkzeuge, Waffen, Textilien, Glas etc.) gegen Sklaven,
transportierte diese nach Westindien, wo man für sie Zucker, Tabak und
Gewürze erhielt, die sich dann wieder in Europa mit großem Profit
verkaufen ließen. Ein Sklave, den man in Afrika für Branntwein
und minderwertige Tauschartikel im Wert von 5 Gulden erwerben konnte, brachte
in Südamerika gut das Zehnfache in Zucker, der in Europa wiederum für
ein Vielfaches verkauft werden konnte. Die Aktien, der im Dreieckshandel
tätigen Gesellschaften, warfen riesige Gewinne ab. Geschickte und skrupellose
Kaufleute wie zum Beispiel die Schimmelpfennigs errichteten sich Schlösser,
erwarben weite Ländereien und wurden in den Adelsstand erhoben. Da wollten
auch die Fürsten nicht hintanstehen und beteiligten sich oder gründeten
eigene Gesellschaften. Doch mit dem Wachstum des Geschäfts und der zunehmenden
Konkurrenz benötigten die Gesellschaften feste Stützpunkte in Afrika,
in denen die Sklaven gesammelt werden konnten, und eigene Plantagen, wo man sie
sicher absetzen konnte.
Die Portugiesen hatten bereits 1482 ihr erstes Fort an der Guineaküste gegründet.
Über hundert Jahre beherrschten sie von dort den Handel mit Sklaven, Gold
und Elfenbein bis sie von den geschäftstüchtigen Holländern daraus
verdrängt wurden. Die raublustige WIC bemächtigte sich der alten portugiesischen
Forts Elmina und Axim, um ihre neuen Eroberungen in Brasilien und der Karibik mit Sklaven
zu versorgen. Bald folgten Engländer und Franzosen, errichteten eigene Forts in
Afrika und eroberten die eine oder andere Zuckerinsel in der Karibik. In Guyana lagen
die niederländischen, französischen und englischen Kolonien dicht an dicht und
an der Goldküste waren die Forts manchmal nur einige Kilometer voneinander entfernt.
Auch Dänen und Schweden errichteten Stützpunkte in Afrika und erwarben karibische
Inselchen. Schließlich gründeten sogar der Herzog von Kurland und der
Kurfürst von Brandenburg einzelne Forts an der Gold- und der Elfenbeinküste.
Einige diese zahlreichen verstreuten afrikanischen Forts und karibischen Kleinstkolonien,
von denen einige Heute noch als Briefmarkenstaaten fortleben, wechselten häufig ihre
Besitzer. Da die Garnisonen winzig waren und eine loyale Bevölkerung fehlte, waren
Kriege in Europa immer ein willkommener Anlass, sich eines Forts oder einer Insel zu
bemächtigen. Manchmal gelang auch einem Häuptling die Eroberung eines Forts
und er verkaufte es dann meistbietend an eine der Kolonialmächte. Accra an der
Goldküste war eine portugiesische Gründung und kam dann in den Besitz der
Niederländer, der Schweden, wieder der Niederländer und schließlich
der Engländer; Gorée im Senegal war zuerst niederländisch und wechselte dann
vier mal zwischen Frankreich und England im Besitz.
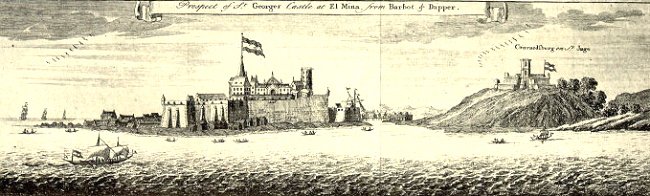
Vor allem unter den Besatzungen der holländischen und dänischen Forts
befand sich immer ein großer Anteil deutscher Söldner. Der Nürnberger
Michael Hemmersam diente in Elmina und war an der Eroberung von Axim beteiligt.
Der erste Kommandeur des dänischen Forts Frederiksborg war Jost Cramer aus
Lindau und sein Nachfolger Henning Albrecht aus Hamburg. Bei der Gründung der
schwedischen Guineakompanie war der Ritter Carloff aus Rostock eine zentrale Figur.
Er war vorher bereits im Dienst der WIC und leistete später den Dänen
ähnliche Dienste.
Doch nach den etwas unruhigen Gründerzeiten erschöpfte sich der Dienst in
Langeweile. Oft reichte der Machtbereich dieser Forts nicht weiter als die Schussweite
ihrer Kanonen, und für die Besatzungen aus zwei, drei Dutzend Weißen waren
die Ankunft eines Schiffes oder einer Sklavenkarawane die großen Ereignisse des
Jahres. Hitze, Ruhr, Gelbfieber, Malaria und der Guineawurm dezimierten die Söldner.
Viele waren krank und verkamen apathisch im Dreck. Aus einigen Forts kamen
nur Bruchteile der Besatzungen zurück. Auf der Zuckerinsel Sao Thomé im Golf von
Guinea herrschte ein derart mörderisches Fieber, dass die WIC die Garnison
als Strafkolonie benützte. Hemmersam, der diese Insel auf der Rückreise kurz
besuchte berichtete, dass selbst die Schildwachen in Stühlen saßen, da sie zu schwach
zum stehen waren. "Und waren diese Völcker den Todten gleicher, als Lebendigen
Menschen", fasste er seinen Eindruck zusammen. Viele empfanden den
Guineawurm als schlimmste Plage. Er wuchs als Parasit unter der Haut und konnte erst
entfernt werden wenn das Geschwür, das sich nach der Eiablage bildete,
geplatzt war. Dann musste man ihn ganz langsam, über mehrere Tage mit einem
kleinen Holz herauswinden. Wenn er dabei abriss, vereiterten die Reste, was zu
Amputationen und zum Tod führen konnte. Fast jeder wurde mehrmals davon
befallen und manche hatten gleichzeitig Dutzende unter der Haut.
 Zwischen Hitze, Krankheiten, Langeweile und der verachteten menschlichen Ware
entfalteten sich die niedrigsten Instinkte der Söldner. In ihrer an Schmutz und
Lastern nicht gerade armen Geschichte bilden die Forts an der Guineaküste
einen verkommenen und verdorbenen Höhepunkt. Abgerissene, vom Fieber ausgezehrte
Gestalten soffen sich um den Rest ihres Verstandes und vergnügten sich mit
schwarzen Sklavinnen und Konkubinen, die jederzeit für etwas Branntwein oder Tabak
zu haben waren. Ein französischer Reisender, der diese Forts im 19. Jahrhundert
besuchte, berichtete, dass sich der dänische Gouverneur von 20 Sklavinnen
bedienen ließ, die außer weißen Servietten keinerlei Kleidung trugen.
Der englische Gouverneur ließ seinen Wagen von vier Schwarzen ziehen, die er dabei mit der
Peitsche antrieb. Natürlich förderten solche Vorbilder die Exzesse unter den
ungebildeten und verrohten Mannschaften. Trotzdem kann man annehmen, dass sich
der Rassismus der einfachen Söldner in Grenzen hielt. Ihre eigene armselige
Existenz diente kaum dazu überheblichkeit und Dekadenz zu fördern. Sie hatten
täglichen Kontakt mit den bei den Forts wohnenden Eingeborenen, trieben Tauschhandel
mit ihnen, aßen in ihren Hütten und lebten oft fest mit schwarzen Frauen
zusammen. Ihren Dienst versahen sie gemeinsam mit einheimischen Söldnern, und
von Gouverneuren und Offizieren nur wenig mehr geachtet. Einige Seeleute,
die auf den Sklavenschiffen fuhren, hatten die Sklaverei bereits am eigenen Leib
erfahren, und fast alle hatten Bekannte, die in den Bagnos von Algier oder
Tunis auf ihren Freikauf warteten.
Zwischen Hitze, Krankheiten, Langeweile und der verachteten menschlichen Ware
entfalteten sich die niedrigsten Instinkte der Söldner. In ihrer an Schmutz und
Lastern nicht gerade armen Geschichte bilden die Forts an der Guineaküste
einen verkommenen und verdorbenen Höhepunkt. Abgerissene, vom Fieber ausgezehrte
Gestalten soffen sich um den Rest ihres Verstandes und vergnügten sich mit
schwarzen Sklavinnen und Konkubinen, die jederzeit für etwas Branntwein oder Tabak
zu haben waren. Ein französischer Reisender, der diese Forts im 19. Jahrhundert
besuchte, berichtete, dass sich der dänische Gouverneur von 20 Sklavinnen
bedienen ließ, die außer weißen Servietten keinerlei Kleidung trugen.
Der englische Gouverneur ließ seinen Wagen von vier Schwarzen ziehen, die er dabei mit der
Peitsche antrieb. Natürlich förderten solche Vorbilder die Exzesse unter den
ungebildeten und verrohten Mannschaften. Trotzdem kann man annehmen, dass sich
der Rassismus der einfachen Söldner in Grenzen hielt. Ihre eigene armselige
Existenz diente kaum dazu überheblichkeit und Dekadenz zu fördern. Sie hatten
täglichen Kontakt mit den bei den Forts wohnenden Eingeborenen, trieben Tauschhandel
mit ihnen, aßen in ihren Hütten und lebten oft fest mit schwarzen Frauen
zusammen. Ihren Dienst versahen sie gemeinsam mit einheimischen Söldnern, und
von Gouverneuren und Offizieren nur wenig mehr geachtet. Einige Seeleute,
die auf den Sklavenschiffen fuhren, hatten die Sklaverei bereits am eigenen Leib
erfahren, und fast alle hatten Bekannte, die in den Bagnos von Algier oder
Tunis auf ihren Freikauf warteten.
Letztendlich unterschied sich ihr eigenes Leben nur wenig von dem der Sklaven, war
manchmal sogar schlimmer. Ein schwedischer Reisender machte die Feststellung, dass
Seeleute und Soldaten oft noch schlechter als Sklaven behandelt wurden. Sklaven
erhielten sogar meistens bessere Nahrung und wurden bei Krankheit gepflegt, denn
ihr Wert belief sich auf mehrere hundert Gulden, während ein neuer Soldat
schon für ein Handgeld von neun Gulden in Amsterdam zu haben war. Man kennt
die Bilder von den auf Schiffen zusammengepferchten Sklaven und entwickelt vielleicht
eine vage Vorstellung von ihren Leiden. Weniger bekannt ist dagegen, dass die
Verlustraten unter den Besatzungen bei diesen Transporten meistens wesentlich
höher lagen. Aktionäre und Reeder sorgten sich weit mehr um ihre kostbare
Ware, als um die billigen Söldner. Es lag in der Natur des Merkantilismus,
dass immer noch Menschen freiwillig ein solches Schicksal auf sich nahmen, einzig
beseelt von der Illusion dabei ihr Glück zu machen.
 Doch diese wenigen Verblendeten reichten längst nicht mehr aus, um die Lücken
zu füllen, die Krankheiten und schlechte Versorgung auf den Schiffen und im
Kolonialdienst rissen. Die Seelenverkäufer in den holländischer Häfen
arbeiteten mit allen schmutzigen Tricks, um neue Rekruten zu beschaffen. Ahnungslose
Handwerksburschen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und betrunken gemacht
bis sie "kapitulierten". Wenn jemand in Amsterdam ohne Geld war,
musste er nur bei einem der "Zielverkooper" unterschreiben und erhielt dann Kost
und Logis bis zur Ausfahrt eines passenden Schiffes. Aus gutem Grund wurden
die Kostgänger aber meistens in verliesähnlichen Kellern gefangen gehalten.
Dabei waren die sanitären Verhältnisse und die Verpflegung so erbärmlich, dass die
Geworbenen oft halb verhungert und schwer krank auf die Schiffe kamen. Da den Käufern
die Missstände bekannt waren, bezahlten sie erst, wenn die Neuen eine
gewisse Zeit auf See lebend überstanden hatten. Selbstverständlich wurden
dann alle Unkosten und der Gewinn des Zielverkoopers vom Sold abgezogen. Auch
hier glich sich das Gewerbe immer mehr dem Sklavenhandel an.
Doch diese wenigen Verblendeten reichten längst nicht mehr aus, um die Lücken
zu füllen, die Krankheiten und schlechte Versorgung auf den Schiffen und im
Kolonialdienst rissen. Die Seelenverkäufer in den holländischer Häfen
arbeiteten mit allen schmutzigen Tricks, um neue Rekruten zu beschaffen. Ahnungslose
Handwerksburschen wurden mit falschen Versprechungen angelockt und betrunken gemacht
bis sie "kapitulierten". Wenn jemand in Amsterdam ohne Geld war,
musste er nur bei einem der "Zielverkooper" unterschreiben und erhielt dann Kost
und Logis bis zur Ausfahrt eines passenden Schiffes. Aus gutem Grund wurden
die Kostgänger aber meistens in verliesähnlichen Kellern gefangen gehalten.
Dabei waren die sanitären Verhältnisse und die Verpflegung so erbärmlich, dass die
Geworbenen oft halb verhungert und schwer krank auf die Schiffe kamen. Da den Käufern
die Missstände bekannt waren, bezahlten sie erst, wenn die Neuen eine
gewisse Zeit auf See lebend überstanden hatten. Selbstverständlich wurden
dann alle Unkosten und der Gewinn des Zielverkoopers vom Sold abgezogen. Auch
hier glich sich das Gewerbe immer mehr dem Sklavenhandel an.
Diese armen Teufel hatten nur wenig Grund zur Überheblichkeit. Zumindest die
etwas Intelligenteren empfanden sogar Mitleid. Der Mecklenburger Paul Erdmann
Isert, der als Arzt auf einem dänischen Schiff diente und dort nur knapp einen
Sklavenaufstand überlebte schrieb in einem Brief: "Denken sie sich den Anblick,
einer solchen Menge Unglücklichen! die, weil sie das Schicksal etwa hatten: von
Sklaven-Eltern gebohren zu werden, oder weil sie im Krieg gefangen genommen,
oder auch unschuldig gestolen worden, oder aus anderen gleichgültigen Ursachen
an die Europäer verkauft, nun in schweren Banden von ihrem Vaterlande nach
einem andern geführt werden, das sie nicht kennen." Auch der spätere
Bürgermeister von Kolberg Joachim Nettelbeck, der schon mit elf Jahren als Schiffsjunge
auf einem Sklavenschiff mitgefahren war, lässt in seiner Lebensbeschreibung
ein gewisses Mitgefühl für die "menschliche Ware" und die "armen Kreaturen"
erkennen. Die Roheit mancher Seeleute erklärt er bezeichnenderweise damit, dass sie
auf allen Schiffen "und nicht bloß auf der Sklavenküste ein nur zu gewohnter
Anblick" wäre. In den Augen der Söldner hatten die Sklaven einfach Pech gehabt,
da sie im Krieg gefangen genommen oder von einem geldgierigen König
verkauft worden waren. Manchen von ihnen war ähnliches widerfahren, denn auch
in Europa wurden Gefangene und Untertanen oft genug verkauft.
 Nach der überfahrt kamen die Sklaven an die andere Stütze des
Dreieckshandels, die Plantagen in Westindien. Dort an der versumpften
Küste Guyanas pflanzten die Holländer in ihren Kolonien Surinam,
Berbice und Paramaribo Zucker, Kaffee und Baumwolle. Dadurch wurde die
vorgelagerte Insel Curacao lange Zeit zum bedeutendsten Sklavenmarkt der
Welt. Nirgendwo in Amerika kamen so viele Sklaven auf so wenige Weiße,
und nirgendwo waren die Plantagenbesitzer und Zuckerbarone so voller Grausamkeit
und Menschenverachtung. In ihrer Arroganz und Verdorbenheit übertrafen
sie sogar die Gouverneure an der Guineaküste. Durch die unmenschliche
Behandlung verschlissen sie ihre Sklaven in wenigen Jahren, und da auch
Schwangere keinerlei Schonung zu erwarten hatten, waren sie auf ständigen
Nachschub aus Afrika angewiesen. Die Sklaven wurden beim geringsten Anlass
bis aufs Blut gepeitscht. Nach dem ersten Fluchtversuch wurde ihnen die
Achillessehne durchschnitten, nach dem zweiten ein Bein amputiert. Mit der
Zeit gelang es den Pflanzern sogar, diese Methoden zur allgemeinen Rechtspraxis
in den Kolonien zu machen. Aufrührerische Sklaven wurden an Fleischhaken
aufgehängt, gerädert oder langsam zu Tode gegrillt. Viele Pflanzer
ließen sich von fast nackten Sklavinnen bedienen und sich von ihnen
im Schlaf kühle Luft zufächeln. Bei Gesellschaften führen die
Damen des Hauses ihre schönen Sklavinnen nackt den Gästen vor,
um sie dann wochenweise zu vermieten.
Nach der überfahrt kamen die Sklaven an die andere Stütze des
Dreieckshandels, die Plantagen in Westindien. Dort an der versumpften
Küste Guyanas pflanzten die Holländer in ihren Kolonien Surinam,
Berbice und Paramaribo Zucker, Kaffee und Baumwolle. Dadurch wurde die
vorgelagerte Insel Curacao lange Zeit zum bedeutendsten Sklavenmarkt der
Welt. Nirgendwo in Amerika kamen so viele Sklaven auf so wenige Weiße,
und nirgendwo waren die Plantagenbesitzer und Zuckerbarone so voller Grausamkeit
und Menschenverachtung. In ihrer Arroganz und Verdorbenheit übertrafen
sie sogar die Gouverneure an der Guineaküste. Durch die unmenschliche
Behandlung verschlissen sie ihre Sklaven in wenigen Jahren, und da auch
Schwangere keinerlei Schonung zu erwarten hatten, waren sie auf ständigen
Nachschub aus Afrika angewiesen. Die Sklaven wurden beim geringsten Anlass
bis aufs Blut gepeitscht. Nach dem ersten Fluchtversuch wurde ihnen die
Achillessehne durchschnitten, nach dem zweiten ein Bein amputiert. Mit der
Zeit gelang es den Pflanzern sogar, diese Methoden zur allgemeinen Rechtspraxis
in den Kolonien zu machen. Aufrührerische Sklaven wurden an Fleischhaken
aufgehängt, gerädert oder langsam zu Tode gegrillt. Viele Pflanzer
ließen sich von fast nackten Sklavinnen bedienen und sich von ihnen
im Schlaf kühle Luft zufächeln. Bei Gesellschaften führen die
Damen des Hauses ihre schönen Sklavinnen nackt den Gästen vor,
um sie dann wochenweise zu vermieten.
Die Macht dieser unglaublich reichen holländischen Pflanzer und Zuckerbarone sicherten kleine Söldnertrupps, deren Mannschaften zum Großteil aus Deutschland,
Frankreich Polen und Dänemark kamen. Durch schlechte Behandlung, Gelbfieber und all die anderen Krankheiten starben sie oft noch schneller als die Sklaven.
Deshalb versuchten auch von ihnen immer wieder einige ihr Glück in der Flucht. Doch die meisten Deserteure wurden im undurchdringlichen Dschungel von
indianischen Kopfjägern schnell wieder eingefangen und ohne Gnade gehängt oder erschossen. Also ertränkten sie ihr Elend im Alkohol, vegetierten mit ihren
schwarzen Konkubinen in den Garnisonen und hofften, lange genug zu überleben, bis die Kompanie eines Tages so gnädig sein würde, sie zu entlassen. Einige
wurden der Kompanie von Pflanzern abgekauft und fristeten ihr Leben als Aufseher, bis sie auch dort wegen fortgesetzter Trunkenheit entlassen wurden. Aber
immerhin war dies noch der häufigste Weg, dem Militär zu entkommen. Manchmal, wenn sich größere Trupps einig waren, entlud sich der angestaute Frust in
Meutereien. So bemächtigte sich 1763 eine Gruppe von deutschen und französischen Deserteuren, die in Holland gepresst worden waren, in Paramaribo eines
Truppentransporters und segelte nach Brasilien. Als sie dort von den Portugiesen vertrieben wurden, versuchten sie ihr Glück in Cayenne, wo sie von den
Franzosen verhaftet und wieder nach Surinam ausgeliefert wurden. Die Rädelsführer wurden hingerichtet und die anderen zum weiteren Dienst begnadigt.
Eine ähnliche Geschichte ereignete sich im selben Jahr beim großen Sklavenaufstand in Berbice. Innerhalb von Tagen stand die ganze Kolonie in Flammen. Die
Sklaven brannten die Plantagen und Zuckermühlen nieder und erschlugen ihre verhassten Unterdrücker. Da der Gouverneur zu diesem Zeitpunkt nur über ganze
zehn gesunde Söldner verfügte, konnte nur Fort St. Andries an der Küste gehalten werden. Während die Sklaven jedoch mit Plündern und dem Machtgerangel
ihrer Anführer beschäftigt waren, erreichten die ersten Verstärkungen das bedrängte Fort. Das Hauptproblem der Sklaven war jedoch ihre schlechte Bewaffnung.
Die Masse verfügte lediglich über Buschmesser, Sicheln, Stangen und andere Arbeitsgeräte. Mit den wenigen erbeuteten Musketen konnten sie nicht umgehen,
außerdem mangelte es ihnen bald an Munition. Da wurde aus dem benachbarten Surinam ein Trupp von 70 vorwiegend deutschen und französischen Söldnern
auf dem Landweg zur Verstärkung geschickt. Man weiß nicht auf welche Weise diese Männer in den Besitz der Kompanie gelangt waren. Vielleicht waren es
ehemalige Kriegsgefangene oder gepresste Deserteure, deren Kapitulationen bereits mehrmals willkürlich verlängert worden waren. Jedenfalls meuterte der
Großteil von ihnen. Sie überwältigten ihre Offiziere, und 40 von ihnen schlugen sich unter der Führung des Franzosen Jean Renaud und des deutschen
Wundarztes Johann Carl Mangemeister in die Büsche, um sich den Aufständischen anzuschließen. Als sie jedoch auf die Sklaven trafen fielen diese über sie
her und massakrierten 28 von ihnen, bevor der Irrtum aufgeklärt werden konnte. Die Überlebenden waren trotzdem eine äußerst wertvolle Unterstützung. Sie
dienten nicht nur als Ausbilder und Schützen, sondern konnten auch Musketen reparieren und Pulver herstellen, und Mangemeister nahm sich sachkundig
der Verwundeten an.
 Überläufer hatte es schon immer gegeben und von allen Kolonialarmeen flohen Söldner zu einheimischen Fürsten und Häuptlingen. Meistens hörte man nie mehr
etwas von ihnen; in Berbice berichten die Gerichtsakten von ihrem Schicksal. Die Meuterer waren von Anfang an ohne jede Chance. In manchem glichen sie
römischen Legionären, die sich den Aufständischen einer Provinz angeschlossen hatten. Gegen die Übermacht des Imperiums waren diese Rebellionen letzten
Endes genauso aussichtslos, wie der Kampf einiger tausend Sklaven gegen das holländische Kolonialreich. Nur wurden Legionäre meistens mit Gold gekauft,
während die Renegaten in Berbice nur eine Hand voll Reis und etwas Zuckerrohrschnaps erwarten konnten. Doch gerade dadurch wird deutlich, wie groß ihr Hass
und ihre Verzweiflung gewesen sein müssen. Im Gegensatz zu den Sklaven wussten sie nur allzu gut, dass die Holländer immer neue Schiffe mit Söldnern schicken
würden. Trotzdem hatten sie sich dieser verlorenen Sache angeschlossen. Allerdings wohl kaum aus Sympathie für die Sklaven, sondern eher aus dem alten Trotz
der Landsknechte. Sie waren weder Helden noch Revolutionäre, sondern Meuterer und Renegaten, und deshalb kämpften sie erbittert und warteten betrunken auf
den Tod oder den Henker. Der Aufstand endete, wie solche Aufstände damals immer endeten. Während die Sklaven langsam ihren Elan verloren, kam die
niederländische Militärmaschine in Gang. Nach einigen verzweifelten Gefechten unterwarfen sich die ersten halbverhungerten Sklaven und baten um Gnade.
Schließlich war alles verloren und die siegreiche Kolonialmacht hielt das übliche Strafgericht. Die Rädelsführer wurden barbarisch zu Tode gefoltert. Von den
Deserteuren waren nur drei in Gefangenschaft geraten, was darauf schließen lässt, dass sie sich bis zuletzt gewehrt hatten. Alle drei, unter ihnen Renaud und
Mangemeister, erlitten den grausamen Tod auf dem Rad.
Überläufer hatte es schon immer gegeben und von allen Kolonialarmeen flohen Söldner zu einheimischen Fürsten und Häuptlingen. Meistens hörte man nie mehr
etwas von ihnen; in Berbice berichten die Gerichtsakten von ihrem Schicksal. Die Meuterer waren von Anfang an ohne jede Chance. In manchem glichen sie
römischen Legionären, die sich den Aufständischen einer Provinz angeschlossen hatten. Gegen die Übermacht des Imperiums waren diese Rebellionen letzten
Endes genauso aussichtslos, wie der Kampf einiger tausend Sklaven gegen das holländische Kolonialreich. Nur wurden Legionäre meistens mit Gold gekauft,
während die Renegaten in Berbice nur eine Hand voll Reis und etwas Zuckerrohrschnaps erwarten konnten. Doch gerade dadurch wird deutlich, wie groß ihr Hass
und ihre Verzweiflung gewesen sein müssen. Im Gegensatz zu den Sklaven wussten sie nur allzu gut, dass die Holländer immer neue Schiffe mit Söldnern schicken
würden. Trotzdem hatten sie sich dieser verlorenen Sache angeschlossen. Allerdings wohl kaum aus Sympathie für die Sklaven, sondern eher aus dem alten Trotz
der Landsknechte. Sie waren weder Helden noch Revolutionäre, sondern Meuterer und Renegaten, und deshalb kämpften sie erbittert und warteten betrunken auf
den Tod oder den Henker. Der Aufstand endete, wie solche Aufstände damals immer endeten. Während die Sklaven langsam ihren Elan verloren, kam die
niederländische Militärmaschine in Gang. Nach einigen verzweifelten Gefechten unterwarfen sich die ersten halbverhungerten Sklaven und baten um Gnade.
Schließlich war alles verloren und die siegreiche Kolonialmacht hielt das übliche Strafgericht. Die Rädelsführer wurden barbarisch zu Tode gefoltert. Von den
Deserteuren waren nur drei in Gefangenschaft geraten, was darauf schließen lässt, dass sie sich bis zuletzt gewehrt hatten. Alle drei, unter ihnen Renaud und
Mangemeister, erlitten den grausamen Tod auf dem Rad.
