Fahrende Ritter - II
Von den Militärtouristen des Imperialismus bis zu den Rambos in Bosnien.
Mit der Zeit fanden sich viele Adlige damit ab, ihren Fürsten
als Offiziere in den neuen stehenden Armeen zu dienen. Denn für die
Fürsten hatte sich der Militärdienst als wichtiges Mittel erwiesen,
um den eigenen unruhigen Adel etwas zu befrieden, und so waren sie diesem
sehr entgegengekommen. Die Offiziersstellen wurden fast ausschließlich
für den Adel reserviert und die Uniformen immer prächtiger. In
jeder Armee gab es exklusive Garderegimenter und vor allem zählte
die Kavallerie wieder etwas. Natürlich gab es weiterhin jede Menge
Abenteurer und Glücksritter, die in fremden Diensten oder auf eigene
Faust ihrem Glück hinterher jagten - vielleicht sogar mehr als jemals
zuvor. Es fällt jedoch auf, dass sie ihr realitätsfernes Gebaren
weitgehend verloren haben, das diese Schicht in der Umbruchszeit des 15.
und 16. Jahrhunderts so deutlich charakterisierte. Im Ancien Régime
trifft man kaum auf den Typus des fahrenden Ritters, da sich die adlige
Lebenswelt mit all ihren Symbolen und Ritualen im Offizierskorps noch einmal
verwirklichte. Auch die Französische Revolution änderte vorerst
nur wenig daran. Die ganze Entwicklung erfuhr unter
Napoleon eher noch
einmal einen letzten hybriden Höhepunkt. Uniformen und Orden wurden
noch pompöser, die Kavallerieattacken noch schneidiger und Abenteuer
gab es im Sonderabgebot.

Das böse Erwachen kam danach. Eine ganze Generation war von Glanz
und Heroismus der napoleonischen Kriege geprägt worden und musste
sich nun wieder in die Banalitäten des Friedens finden. Fast noch
schlimmer war es für die zu spät Geborenen. Sie wurden mit Memoiren
und Erzählungen der "glorreichen Zeit" groß gezogen, nur um
festzustellen, dass die Welt keine Helden mehr brauchte. Typisch für
sie ist vielleicht der dem österreichischen Hochadel entstammende
Fürst Friedrich von Schwarzenberg. Erst 1800 geboren sehnte er sich
sein ganzes Leben nach einem "Gewittersturm", was er dann so formulierte:
"Für die jüngeren Leute, welche in dieser Glanzepoche der Dampf-
und Eisenbahmmirakel aufgewachsen sind, welche das goldene Zeitalter und
das goldene Kalb anbeten, ist dieses Bedürfnis weit geringer; aber
unsereiner, den die Mutter unter dem Donner der Kanonen einlullte, an dessen
Wiege die Riesenschatten der napoleonischen Kaiserzeit vorüberwandelten,
der in der damaligen eisernen Zeit mit der Feuertaufe sub invocatione Schills,
Hofers, Körners getauft wurde, dem ist und wird nicht wohl in dieser
Aktienwelt; mitsamt aller ihrer Dampf-, Gold- und Papierherrlichkeit ist
es denn doch eine Misere."
Gelangweilt vom andauernden Frieden nahm Schwarzenberg als Hauptmann
seinen Abschied und schloß sich den Franzosen bei der Eroberung von Algier
an. 1838 ging er dann nach Spanien zu den Carlisten. In den 40er Jahren
nahm er als Tourist lediglich an mehreren preußischen und österreichischen
Manövern teil. 1846 diente er wieder in der österreichischen
Armee während des galizischen Aufstandes. Dann eilte er zum Aufstand der
katholischen Kantone in die Schweiz und kämpfte anschließend
in Ungarn und Italien. Seine Memoiren betitelte er bezeichnenderweise "Aus
dem Wanderbuch eines verabschiedeten Landsknechts", wodurch seine rückwärts
gewandte romantisierende Einstellung unterstrichen wird.
Männer wie Schwarzenberg waren absolut keine Seltenheit. Zu ihm
und seinen Standesgenossen waren sogar noch jede Mange bürgerliche
Ex-Offiziere gestoßen, und da die Großmächte in Europa
in der ersten Hälfte des Jahrhunderts große Konflikte vermieden,
kann man für diese Zeit wahrscheinlich in jeder noch so unbedeutenden
Revolution oder noch so vergessenem Kleinkrieg im letzten Winkel der Welt
einige Veteranen der napoleonischen Kriege entdecken. Viele erwiesen sich
als gute Soldaten und passten sich den neuen Gegebenheiten an. Andere wurden
jedoch als echte fahrende Ritter auf einer Woge von Idealismus herangespült.
So diskutierten die Freiwilligen, die Simon Bolivar zu Hilfe eilen wollten,
wochenlang Farbgebung und Zuschnitt ihrer neuen Uniformen und zerstritten
sich über die Rangordung.
Am deutlichsten wird der Bruch zwischen Vorstellung und Realität
aber bei den sogenannten Philhellenen, die nach dem griechischen Aufstand
von 1821 nach Griechenland zogen. Sold war dort nicht zu erwarten und die
meisten mußten sich selbst ausrüsten und auf eigene Kosten reisen.
Aber viele ehemalige Offiziere träumten von einer steilen Karriere
in einer noch zu gründenden griechischen Armee und von glorreichen
Heldentaten, von einem Kampf um Troja, von Perserkriegen und Alexanderzügen.
Doch wie immer, wenn Träumer in den Krieg ziehen, folgte die Ernüchterung
auf dem Fuß. Statt einem von edlen Hellenen bewohnten blühenden
Arkadien fanden sie ein Land mit wildem Dornengestrüpp und stinkenden
Schäfern. Niemand hatte auf sie gewartet und die Bevölkerung
zeigte nur wenig Enthusiasmus, war unfreundlich und verlangte gutes Geld
für Unterkunft und Verpflegung. Viele der Neuankömmlinge reisten
deshalb, nachdem sie ihr ganzes Geld ausgegeben hatten, unverrichteter
Dinge und enttäuscht wieder ab. Andere starben in dem Fischerdorf
Missolunghi am Fieber. Unter ihnen der berühmte englische Dichter
Lord Byron, den ebenfalls das Fieber hinwegraffte, bevor er große
Heldentaten vollbringen konnte. Zudem führten die Griechen einen äußerst
grausamen Partisanenkrieg, in dem türkische Gefangene gefoltert und
Zivilisten massenhaft abgeschlachtet wurden. In den wenigen Gefechten schlugen
sich die Philhellenen zwar tapfer, indem sie sich der türkischen Übermacht
entgegenstellten, wie das europäische Infanterie eben so machte. Die
Griechen verachteten sie dagegen als Feiglinge, da diese lediglich aus
der Deckung ein paar Schüsse abgaben und dann das Weite suchten. Zu
der Einsicht, dass diese einen der Situation angemessen Kampf führten,
konnten sie sich nicht durchringen.
 Aber auch nachdem die von der napoleonischen Zeit direkt geprägten
Generationen in die Jahre gekommen war, riss der Strom an gelangweilten
Offizieren nicht ab. Sehr beliebt war es, sich beurlauben zu lassen und
sich der Armee einer kriegsführenden Macht als "Beobachter" anzuschließen.
Hierzu boten die Kolonialkriege der Engländer und Franzosen immer
mal wieder Gelegenheit. Mit etwas Glück kam man dabei auch wirklich
mal zum Schuss und konnte ein paar exotische Trophäen mit nach Hause
bringen. Große Risiken waren mit diesen Expeditionen selten verbunden.
So schreibt die China Mail 1862 über die Feldzüge der Europäer
gegen die Taiping in China: "An expedition against the rebels is now shown
to be so harmless to those engaged in it that we may expect to hear of
gentlemen giving their wives and sisters a pic-nic in front of the next
town that is besieged, when we have no doubt that much amusement could
be had among the engineers and artillery by allowing the girls to point
the guns. And this is the sort of warfare in which the heart of the jaded
and harassed soldier is to be cheered with loot!"
Aber auch nachdem die von der napoleonischen Zeit direkt geprägten
Generationen in die Jahre gekommen war, riss der Strom an gelangweilten
Offizieren nicht ab. Sehr beliebt war es, sich beurlauben zu lassen und
sich der Armee einer kriegsführenden Macht als "Beobachter" anzuschließen.
Hierzu boten die Kolonialkriege der Engländer und Franzosen immer
mal wieder Gelegenheit. Mit etwas Glück kam man dabei auch wirklich
mal zum Schuss und konnte ein paar exotische Trophäen mit nach Hause
bringen. Große Risiken waren mit diesen Expeditionen selten verbunden.
So schreibt die China Mail 1862 über die Feldzüge der Europäer
gegen die Taiping in China: "An expedition against the rebels is now shown
to be so harmless to those engaged in it that we may expect to hear of
gentlemen giving their wives and sisters a pic-nic in front of the next
town that is besieged, when we have no doubt that much amusement could
be had among the engineers and artillery by allowing the girls to point
the guns. And this is the sort of warfare in which the heart of the jaded
and harassed soldier is to be cheered with loot!"
Man sollte nicht glauben, dass sich diese Herren bei ihren Abenteuern
immer "gentlemanlike" benahmen, gerade die Kolonialkriege erwiesen sich
als ein Refugium, wo einige ihre niedrigsten Instinkte ungehemmt ausleben
konnten. Es zahlreiche Berichte über die Massaker und Plünderungen
europäischer Truppen in China oder Indien. In Nordamerika versuchten
einige einen echten Indianerskalp zu erbeuten und in Neuseeland waren sie
hinter den Köpfen der Maoris her. Als
Stanley 1887 zu einer neuen Kongo-Expedition aufbrach, war der Andrang
britischer Gentlemen groß.
Später spielten sich dann am Kongo Szenen von solcher Grausamkeit
ab, dass selbst der nicht gerade zart besaitete Stanley darüber schrieb,
seine Offiziere hätten Dinge getan, die zu schrecklich und barbarisch
gewesen seien um sie zu beschreiben. Joseph Conrad ließ sich dann
unter anderem von diesen Ereignissen zu seinem Roman "Im Herz der Finsternis"
anregen.
Nur in seltenen Ausnahmen ereilte den einen oder anderen sein Schicksal
in einer archaischen Form, die dieser Art von Abenteurreise angemessen
erscheint. So als die Briten 1883 ein Expeditionskorps zum Entsatz des
belagerten Khartoum unter Colonel Hicks in den Sudan schickten. Unter den
wenigen Europäern in diesem Korps befanden sich zwei österreichische
Hauptleute und der deutsche Major Goetz Burckhard Baron von Seckendorff.
Seckendorff hatte bereits 1867/68 die britische Expedition nach Abessinien
als offizieller Beobachter begleitet und darüber ein Buch geschrieben.
Als das ganze Korps dann von den Mahdisten überrannt und
völlig aufgerieben wurde, brachten diese Seckendorffs Kopf, den sie
wegen seines langen blonden Bartes für den von Hicks gehalten hatten,
im Triumph zum Mahdi.
 Natürlich waren diese Männer meistens tapfere schneidige Kavalleristen
- schließlich hatten sie nicht viel mehr gelernt. Aber sie waren
es nur zu oft auf eine weltfremde arrogante Art und Weise, die sich nur
mit der des spätmittelalterlichen Rittertums vergleichen lässt.
Ein treffendes Beispiel dieser Geisteshaltung ist die Schlacht von Omdurman,
in der die Briten die über 50.000 Mann starke Armee der Mahdisten
mit dem disziplinierten Salvenfeuer ihrer Kolonialinfanterie und modernen
Maschinengewehren massakrierten, ohne dass auch nur ein Derwisch näher
als 300 Meter an die britischen Linien herankam. Da dies für die britischen
Offiziere natürlich etwas unbefriedigend war, befahl Kitchener - er
erlaubte wohl eher - noch eine Kavallerieattacke der 21. Lancers auf die
geschlagenen Mahdisten. Es war das einzige Mal, dass sich diese wirklich
zur Wehr setzen konnten, und sie richteten die Lancers furchtbar zu, bevor
diese ihre Reihen durchbrochen hatten. Winston Churchill, der als junger
Mann an der Attacke teilnahm, schreibt darüber: "Reiterlose Pferde
galoppierten über die Ebene. Männer klammerten sich an ihren
Sätteln fest, oder hingen schwankend darauf, bedeckt mit Blut aus einem
Dutzend Verletzungen. Die Pferde verströmten Blut aus furchtbaren
Wunden, hinkten und taumelten mit ihren Reitern. In 120 Sekunden waren
fünf Offiziere, 66 Mann und 119 Pferde von weniger als 400 getötet
oder verwundet worden." Letzten Endes gab es allerdings nur 21 Tote und
dafür regnete es Orden und Auszeichnungen - allein drei mal das Victoria
Cross -, und alle Teilnehmer wurden ihr ganzes Leben lang in den Clubs für
die Teilnahme an diesem Ereignis beneidet.
Natürlich waren diese Männer meistens tapfere schneidige Kavalleristen
- schließlich hatten sie nicht viel mehr gelernt. Aber sie waren
es nur zu oft auf eine weltfremde arrogante Art und Weise, die sich nur
mit der des spätmittelalterlichen Rittertums vergleichen lässt.
Ein treffendes Beispiel dieser Geisteshaltung ist die Schlacht von Omdurman,
in der die Briten die über 50.000 Mann starke Armee der Mahdisten
mit dem disziplinierten Salvenfeuer ihrer Kolonialinfanterie und modernen
Maschinengewehren massakrierten, ohne dass auch nur ein Derwisch näher
als 300 Meter an die britischen Linien herankam. Da dies für die britischen
Offiziere natürlich etwas unbefriedigend war, befahl Kitchener - er
erlaubte wohl eher - noch eine Kavallerieattacke der 21. Lancers auf die
geschlagenen Mahdisten. Es war das einzige Mal, dass sich diese wirklich
zur Wehr setzen konnten, und sie richteten die Lancers furchtbar zu, bevor
diese ihre Reihen durchbrochen hatten. Winston Churchill, der als junger
Mann an der Attacke teilnahm, schreibt darüber: "Reiterlose Pferde
galoppierten über die Ebene. Männer klammerten sich an ihren
Sätteln fest, oder hingen schwankend darauf, bedeckt mit Blut aus einem
Dutzend Verletzungen. Die Pferde verströmten Blut aus furchtbaren
Wunden, hinkten und taumelten mit ihren Reitern. In 120 Sekunden waren
fünf Offiziere, 66 Mann und 119 Pferde von weniger als 400 getötet
oder verwundet worden." Letzten Endes gab es allerdings nur 21 Tote und
dafür regnete es Orden und Auszeichnungen - allein drei mal das Victoria
Cross -, und alle Teilnehmer wurden ihr ganzes Leben lang in den Clubs für
die Teilnahme an diesem Ereignis beneidet.
Das Fatale an dieser Geisteshaltung war, dass sie nicht wie im Spätmittelalter
auf eine kleine elitäre Oberschicht begrenzt blieb. Auch große
Teile des Bürgertums ließen sich von diesen überholten
Wertvorstellungen infizieren. Als dann das Attentat einiger fanatischer
Nationalisten in Sarajewo den Vorwand lieferte, zogen alle Europäer
mit einer heute kaum noch zu verstehenden Begeisterung in das große
Schlachten des Weltkrieges. Diejenigen, die aus Abenteuerlust fremde Dienste
gesucht hatten, eilten nun erlöst zu den nationalen Fahnen. So legte
ein deutscher Oberst in Mexiko seinen Landsleuten nahe, sich nach Hause
durchzuschlagen, um sich dem Vaterland zur Verfügung zu stellen. Auch
die meisten deutschen Militärberater in Südamerika kehrten in
die Heimat zurück. Sogar viele von denen, deren Heimatländer
sich nicht gleich am großen Krieg beteiligten, versuchten als Freiwillige
für ihre Sache zu kämpfen. In Frankreich meldeten sich tausende
von russischen Sozialisten, Italienern, Amerikanern, osteuropäischen
Juden, Armeniern, Kroaten, Griechen und Montenegrinern zur Fremdenlegion.
Doch sie fanden nicht den von Schwarzenberg und anderen herbeibeschworenen
"Gewittersturm", sondern ein bislang unvorstellbares Gemetzel, das mit
modernster Technik, mit Maschinengewehren, Artillerie, Giftgas, Panzern
und Flugzeugen geführt wurde.

Viele der Kriegsfreiwilligen wurden im Krieg zu Pazifisten und selbst
der verspätete Romantiker Jünger, der vor dem Krieg als Minderjähriger
aus Abenteuerlust eine kurze Episode bei der Fremdenlegion gehabt hatte,
mußte ernüchtert feststellen, dass Begeisterung und Idealismus
am "unwiderlegbaren Gegenstand eines Maschinengewehrs" scheiterten. In
Flandern, an der Somme, in Galizien, am Isonzo und bei Verdun fanden die
fahrenden Ritter ihr Ende. Diejenigen, die überlebten, beerdigten
dort ihren Glauben. Ernest Hemingway, der als Freiwilliger nach Italien geeilt war,
prägte anschließend das Schlagwort von der "lost generation".
Die fahrenden Ritter verschwanden damit natürlich nicht völlig von der
Bühne. Das eine oder andere Relikt kann man auch noch danach in inzwischen vergessenen
Kriegen entdecken. Doch es waren verschwindend wenige und unter ihnen kehrte
wieder einmal kühle Professionalität ein. Der Ex-Priesterschüler
und Ex-Fremdenlegionär Rolf Steiner oder der schwedische Aristokrat
Carl Gustav von Rosen, die beide in Biafra für eine verlorene Sache
kämpften, sind sicher solche Gestalten. Aber auch sie blieben Einzelgänger
die keinerlei Einfluss auf die Wertvorstellungen und Ideale ihrer Zeit
hatten. In den westlichen Eliten denkt niemand mehr daran als militärischer
Tourist durch das Töten einiger Eingeborener sein angekratztes Sozialprestige
aufzupolieren.
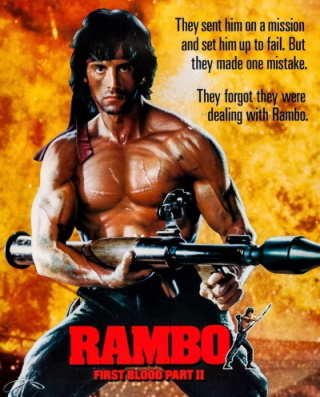 Allerdings scheinen einige dieser Ideen in etwas einfacheren sozialen
Schichten so langsam wieder ein wenig in Mode zu kommen. Wie so vieles
heute kommt dieser Trend aus Amerika, wo der Vietnamkrieg unter der tatkräftigen
Mitwirkung Hollywoods inzwischen in einem ähnlichen Glorienschein
idealisiert wird wie in Europa dereinst die napoleonischen Kriege. Im Actionfilm
haben Söldner und kriegerische Abenteuer wieder Konjunktur. Wohl selten hat
ein einzelnes Accessoir die Mode von Möchtergernsöldnern so beeinflusst
wie Rambos Strirnband. Dass auch
hier wieder einmal Welten zwischen Realität und Vorstellung liegen,
zeigt ein Vergleich zwischen dem von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger
verkörperten Typus mit wirklichen Kriegern. Ein Fachmann des Dschungelkrieges
verglich das Aussehen der Überlebenden mit "Christus bei der Kreuzabnahme
[...] In der Regel sahen sie wirklich so aus: abgemagert zum Skelett durch
Hunger und Ruhr, tief eingefallene Augen, mit der typischen tropischen
Blässe, ganz im Gegensatz zur bronzefarbigen Haut der 'weißen
Jäger', wie sie von Hollywood populär gemacht werden, die abgezehrten
Gesichter mit zottigen Bärten bedeckt, auf der Haut eiternde Wunden
von Hitzeausschlag, Blutegeln und Fäulnisbakterien des Dschungels."
Allerdings scheinen einige dieser Ideen in etwas einfacheren sozialen
Schichten so langsam wieder ein wenig in Mode zu kommen. Wie so vieles
heute kommt dieser Trend aus Amerika, wo der Vietnamkrieg unter der tatkräftigen
Mitwirkung Hollywoods inzwischen in einem ähnlichen Glorienschein
idealisiert wird wie in Europa dereinst die napoleonischen Kriege. Im Actionfilm
haben Söldner und kriegerische Abenteuer wieder Konjunktur. Wohl selten hat
ein einzelnes Accessoir die Mode von Möchtergernsöldnern so beeinflusst
wie Rambos Strirnband. Dass auch
hier wieder einmal Welten zwischen Realität und Vorstellung liegen,
zeigt ein Vergleich zwischen dem von Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger
verkörperten Typus mit wirklichen Kriegern. Ein Fachmann des Dschungelkrieges
verglich das Aussehen der Überlebenden mit "Christus bei der Kreuzabnahme
[...] In der Regel sahen sie wirklich so aus: abgemagert zum Skelett durch
Hunger und Ruhr, tief eingefallene Augen, mit der typischen tropischen
Blässe, ganz im Gegensatz zur bronzefarbigen Haut der 'weißen
Jäger', wie sie von Hollywood populär gemacht werden, die abgezehrten
Gesichter mit zottigen Bärten bedeckt, auf der Haut eiternde Wunden
von Hitzeausschlag, Blutegeln und Fäulnisbakterien des Dschungels."
Trotzdem verkörpern gerade die Bodybuilder aus Hollywood die populären
Vorstellungen, die sich momentan einige potentielle Rekruten von dem Gewerbe
machen. Früher war die Not der mit Abstand stärkste Werber, dazu
kamen Reise- und Abenteuerlust. Heute geht es allein um den Kick des Tötens.
Die amerikanische Zeitschrift "Soldier of Fortune", die fast ausschließlich
von Möchtegernsöldnern gelesen wird, vertreibt T-Shirts mit Aufschrift:
"Join the army, travel to distant lands, meet interesting people and kill
them." Doch die vorwiegend jugendlichen Rambos stehen vor dem grundlegenden
Problem, dass niemand ihre Dienste benötigt. Ein ehemaliger CIA-Söldner,
der im Süden der USA eine Söldnerschule leitete, sagte in einem
Interview, dass viele seiner Kursteilnehmer - unter denen sich auch
Deutsche befanden - auf einem Job in der Dritten Welt hoffen würden,
man dort aber "keine Kerle mit Waffen, sondern Ausbilder" benötigen
würde. Auf der Suche nach einer Anstellung versuchten deshalb vor
allem rechtsgerichtete Franzosen in den siebziger Jahren ihr Glück
bei den christlichen Milizen im Libanon. Aber selbst für einem "Job"
im Libanon benötigte man Beziehungen, und mehr als ein Taschengeld
war für Amateure dort nicht zu verdienen. Das änderte sich, allerdings
nur kurzfristig, mit dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Die Einsatzorte
der kroatischen Milizen wurden nicht nur fast täglich von den Medien
bekannt gegeben, sondern waren auch bequem und preiswert mit der Bahn zu
erreichen. Bei der kroatischen HOS und ähnlichen Gruppierungen versammelten
sich dann auch schnell einige Freiwillige aus Großbritannien, Frankreich,
Italien, den Niederlanden, Österreich und der Bundesrepublik.
Seit der Französischen Revolution hatte sich jede internationale
Freiwilligenformation dagegen gewehrt, als Söldner bezeichnet zu werden,
und spätestens seit den Ereignissen im Kongo waren auch Frankreich
und Großbritannien sehr darum bemüht, dass ihre Legionäre
und Gurkhas als reguläre Soldaten betrachtet wurden. Die Freiwilligen
in Bosnien fanden es dagegen schick, als Söldner aufzutreten, obwohl
bei einem Sold von etwa 130,- DM im Monat eigentlich nicht mehr die Rede
davon sein konnte. Jeder hatte zu Hause ein Vielfaches an Sozialhilfe zu
erwarten. Aber in Gesellschaften, in denen man zum Abenteuerurlaub an fast
jeden Ort der Welt aufbrechen kann, erscheint das Killen manchem als die
letzte Grenzerfahrung. Indem sie einen archaischen Männlichkeitskult
zelebrieren wo High-Tech gefragt ist, sind die jugendlichen Rambos allerdings
selbst ein überaus treffendes Beispiel für die von ihnen so sehr
verurteilte westliche Dekadenz. Dabei sind sie aber inzwischen zu einer
solch banalen Randerscheinung geworden, dass sich wohl kein Cervantes
mehr mit dem Problem dieser fahrenden Ritter beschäftigen wird.
