Die Schweizer
Reisläufer aus den Alpen.
 Wenn man von einem Söldnervolk par excellence sprechen kann, so sind
das zumindest in Europa die Schweizer. Wahrscheinlich gibt es aber weltweit
kein Volk, das mit einer solchen Ausdauer und Anzahl in fremden Kriegen
gekämpft hat. Vom späten 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert
wurde in Europa kaum eine große Schlacht geschlagen, ohne dass ein
Kontingent Schweizer beteiligt war - manchmal sogar auf beiden Seiten.
Der Erfolg der Schweizer beruhte vor allem darauf, dass durch sie das Fußvolk
wieder zur entscheidenden Waffe wurde. Über Jahrhunderte hatten die
schweren Panzerreiter, die "Ritter" die Schlachtfelder des Abendlandes
beherrscht. Zwar hatten auch sie einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen,
doch diese hatten sie meistens durch ihre eigene Überheblichkeit verursacht.
Das Fußvolk - die englischen Bogenschützen, die flämischen
Bürgerwehren oder die Hussiten - hatte seine Siege vorwiegend aus
stark defensiven Positionen heraus erkämpft. Die Engländer wurden
aus Frankreich vertrieben, nachdem ihre Gegner gelernt hatten, durch die
Kombination verschiedener Waffen selbstmörderische Angriffe zu vermeiden.
Flamen und Hussiten wurden auf ähnliche Weise geschlagen. Die Erfolge
des Fußvolks hatten zwar dazu geführt, dass man ihm in den neuen
Heeren eine stärkere Bedeutung einräumte. So verwendete man gerne
eine Kombination aus Schützen, Spießern und Reitern und stützte
sich zudem auf eine Wagenburg. Die alles entscheidende Waffe blieb dennoch
die schwere Reiterei. Von diesem Thron sollte sie erst - und zwar äußerst
nachhaltig - von den Schweizern gestoßen werden.
Wenn man von einem Söldnervolk par excellence sprechen kann, so sind
das zumindest in Europa die Schweizer. Wahrscheinlich gibt es aber weltweit
kein Volk, das mit einer solchen Ausdauer und Anzahl in fremden Kriegen
gekämpft hat. Vom späten 15. bis ins frühe 19. Jahrhundert
wurde in Europa kaum eine große Schlacht geschlagen, ohne dass ein
Kontingent Schweizer beteiligt war - manchmal sogar auf beiden Seiten.
Der Erfolg der Schweizer beruhte vor allem darauf, dass durch sie das Fußvolk
wieder zur entscheidenden Waffe wurde. Über Jahrhunderte hatten die
schweren Panzerreiter, die "Ritter" die Schlachtfelder des Abendlandes
beherrscht. Zwar hatten auch sie einige schwere Niederlagen hinnehmen müssen,
doch diese hatten sie meistens durch ihre eigene Überheblichkeit verursacht.
Das Fußvolk - die englischen Bogenschützen, die flämischen
Bürgerwehren oder die Hussiten - hatte seine Siege vorwiegend aus
stark defensiven Positionen heraus erkämpft. Die Engländer wurden
aus Frankreich vertrieben, nachdem ihre Gegner gelernt hatten, durch die
Kombination verschiedener Waffen selbstmörderische Angriffe zu vermeiden.
Flamen und Hussiten wurden auf ähnliche Weise geschlagen. Die Erfolge
des Fußvolks hatten zwar dazu geführt, dass man ihm in den neuen
Heeren eine stärkere Bedeutung einräumte. So verwendete man gerne
eine Kombination aus Schützen, Spießern und Reitern und stützte
sich zudem auf eine Wagenburg. Die alles entscheidende Waffe blieb dennoch
die schwere Reiterei. Von diesem Thron sollte sie erst - und zwar äußerst
nachhaltig - von den Schweizern gestoßen werden.
Die stärkste Streitmacht am Ende des Mittelalters unterhielt wahrscheinlich
Herzog Karl der Kühne von Burgund. Je nach Gelegenheit führte
er Krieg gegen Frankreich oder das Reich; dem König von England -
einem armen Verwandten - lieh er dagegen manchmal ein paar Söldner.
In den burgundischen Ordonanzkompanien entfaltete das spätmittelalterliche
Rittertum noch eine seine ganze Pracht. Die schwer bewaffneten Gens d’armes
kämpften aber schon lange nicht mehr alleine. Sie wurden von einem
erprobten Fußvolk - darunter viele in England geworbene Bogenschützen
- und einer starken Artillerie unterstützt. Diese bislang unbesiegte
Militärmaschine schlugen die Schweizer Aufgebote 1476/77 vernichtend
in den Schlachten von Grandson, Murten und Nancy. Der fundamentale Unterschied
zu den früheren Erfolgen des Fußvolks war, dass hier kein vereinzelter
Sieg unter geschickter Ausnutzung von Geländevorteilen erfochten worden
war. Das Schweizer Fußvolk hatte auf sich selbst gestellt in einer
ganzen Kette offener Feldschlachten seine Gegner einfach überrannt.
Das Resultat dieser spektakulären Siege war, dass plötzlich
alle Mächte an Schweizer Söldnern, den Reisläufern interessiert
waren - bereits die Schlacht bei Nancy hatten die Schweizer ja im Sold
des Herzogs von Lothringen geschlagen. Die Abgesandten von Fürsten,
Kaisern und Königen, von Päpsten und Kardinälen warben um
ihre Unterstützung. Es blieb aber nicht allein bei der Werbung; an
vielen Orten begann man damit eigenes Fußvolk nach Schweizer Muster
auszubilden. Dazu wurde oft eine größere Gruppe Schweizer angeworben,
die dann im Verbund mit den Einheimischen als Instrukteure und Korsettstangen
dienen sollten. Innerhalb weniger Jahre stützten sich alle Großmächte
entweder auf Schweizer Söldner oder auf Infanterieformationen, die
diesen in Ausrüstung und Taktik sehr ähnlich waren. Die schwere
Kavallerie stieg dabei zu einer unterstützenden Waffengattung ab.
Am stärksten war der Einfluss der Schweizer sicher in Süddeutschland
und in Tirol, wo unter ihrem direkten Einfluss die Landsknechte entstanden.
Doch gerade im Vergleich mit anderen Reichsteilen sollte man sich die Frage
stellen, wie denn der durchschlagende Erfolg der Schweizer eigentlich möglich
gewesen war. Das Aufgebot der mächtigen süddeutschen Städte
war 1388 bei Döffingen vom Adel geschlagen worden, und der große
Bauernkrieg von 1525 war militärisch ein einziges Desaster. Städte
und Bauern spielten nach diesen Niederlagen zumindest aktiv keine große
Rolle mehr; sogar die Hanse im Norden musste auf ihre einstige Großmachtpolitik
verzichten. Da die Dominanz der Schweizer Reisläufer auf dem europäischen
Söldnermarkt wohl kaum in einer genetischen Disposition zu suchen
ist - man denke nur an den geradezu pazifistischen Ruf der modernen Schweiz
- , ist die Antwort in ihrer Geschichte zu suchen.
Der Ursprung des Schweizer Sonderweges liegt sicher darin, dass in den
Alpentälern der Urschweiz einige Privilegien seit der Karolingerzeit
erhalten worden waren. Sicherung und Pflege des St. Gotthard-Passes der
wichtigsten Handelsverbindung zwischen Süddeutschland und Norditalien
lagen weitgehend in den Händen kleiner Landgemeinden, die in Krisenzeiten
den fränkischen Heerbann aller Waffenfähigen aufboten und ihre
politischen und militärischen Führer selbst wählte. Natürlich
gab es auch Adlige, aber deren Macht erstreckte sich oft nur auf kleinere
Bereiche. Unter den staufischen Kaisern, als der Feudalismus fast überall
im Reich an Boden gewann, wurde der Weg über den St. Gotthard zu einer
Überlebensfrage und die Bewohner von Uri erhielten von Kaiser Friedrich
II 1231 die Reichsunmittelbarkeit und wurden 1240 von fremder Gerichtsbarkeit
befreit. Damit hatten sie ungefähr den Status einer freien Reichsstadt.

Gerichtshoheit bedeutete aber nicht nur Befreiung von Steuern und Abgaben,
sondern auch die Ausübung der Polizeigewalt. Die Aufgebote mussten
gegen Friedensstörer vorgehen, Burgen brechen und Strafexpeditionen
durchführen. Es waren keine ruhigen Zeiten, aber die Bewohner der
Urschweiz waren auch alles andere als ein friedliebendes Volk. Wie in anderen
kargen Bergregionen Europas - z.B. dem schottischen Hochland oder den Pyrenäen
- gehörten kleine Überfälle, Fehden und vor allem Viehraub
fast zur Tagesordnung. Die Urschweizer galten deshalb als äußerst
rauflustige und kriegerische Gesellen. Da zudem die Almwirtschaft nur unzureichend
für Beschäftigung sorgte wurde der Reislauf bereits sehr früh
zu einer Art Nebenerwerb. Wenn die Heere der deutschen Kaiser über
die Alpen zogen, schlossen sich ihnen meistens auch abenteuerlustige Gesellen
aus der Schweiz an. 1241 kämpfte sogar eine große Gruppe Schwyzer
vor Faenza; 1278 standen sie im Heer Rudolfs von Habsburg gegen Ottokar
von Böhmen und erhielten zum Dank für ihre Leistungen das rote
Banner als Zeichen der kaiserlichen Freiheiten. Trotzdem waren es zu dieser
Zeit noch keine spektakulären Werbungen. Viele Schweizer verdingten
sich bei den Viehhändlern und Maultierkarawanen als Treiber oder Begleitschutz
und kamen auf diese Weise nach Italien, wo auch nach dem Ende der Staufer
konstanter Bedarf an kräftigen Kriegsknechten herrschte.
Vielleicht wäre es dabei geblieben und die Schweizer hätten
wie Gascogner oder Waliser ihre offiziellen Herrscher über Jahrhunderte
mit tapferem Fußvolk versorgt. Der große Bruch begann als die
Habsburger, deren Stammlande ja in der Schweiz lagen, als deutsche Kaiser
damit begannen ihre Macht auszudehnen. Der Konflikt mit den an ihre Freiheit
gewohnten und kampferprobten Bergbewohnern wurde dadurch unvermeidlich.
Gegen den Machtanspruch der Habsburger schlossen die drei Unterkantone
Uri, Schwyz und Unterwalden 1291 den "Ewigen Bund". Zum Glück für
die Schweizer hatten die Habsburger aber durch den Erwerb Österreichs
ihr Machtzentrum stark nach Osten verlagert und waren hauptsächlich
mit ihrem Machtkampf mit den Luxemburgern beschäftigt, an die auch
die Kaiserkrone gefallen war. So gelang es den Schweizern das Habsburger
Ritterheer 1315 bei Morgarten zu schlagen. Morgarten war sicher ein beeindruckender
Sieg, war aber unter geschickter Ausnutzung des Geländes erfochten
worden. So hatte das Schweizer Aufgebot die Habsburger in einem Engpass
überrascht, der dann durch herabgestürzte Felsbrocken und Baumstämme
blockiert worden war. Ähnliche Siege waren auch von den Dithmarschen
oder Friesen erkämpft worden; bezeichnenderweise Gemeinschaften, die
sich ihre organisatorischen und militärischen Freiheiten zum Teil
durch die Landgewinnung an der Nordsee erhalten hatten.
Im Unterschied zu den norddeutschen Bauerngemeinden entwickelten die
Urkantone jedoch eine große Anziehungs- und Integrationskraft, durch
die sich immer mehr Talschaften und Städte dem Bündnis anschlossen.
Als erste traten Luzern, Zürich, Zug und Glarus traten bei; Bern folgte
etwas später. Auch wenn die nächste große Schlacht mit
den Habsburgern bis 1386 auf sich warten ließ, sollte man nicht denken,
dass es sich dabei um eine Friedensperiode gehandelt habe. Die Ausdehnung
der Schweiz wurde konstant von kriegerischen Aktionen begleitet, von Überfällen
und Gefechten bis zu drei vergeblichen Belagerungen Zürichs. Dazwischen
fielen mehrmals überschüssige Söldnertruppen aus Frankreich
in die Schweiz ein und mussten abgeschlagen werden (1365 und 1375).
 Der Söldnerdienst ging neben dieser Ausdehnungspolitik ungehindert
weiter; man kann sogar sagen, dass sich beide Momente wahrscheinlich verstärkten.
Die unruhigen und kriegserfahrenen Reisläufer, die "Kriegsgurgeln"
bildeten das Rückgrat der Volksaufgebote, und je mehr die Schweiz
expandierte und an Selbstvertrauen gewann, desto mehr Bauernsöhne
betrachteten den Kriegsdienst als Broterwerb. Obwohl in der Not auch gut
situierte Bürger und Bauern mit den Aufgeboten auszogen, dominierten
die Kriegsgurgeln. Ihr wichtigstes Rekrutierungsreservoir waren die Jungmännerbünde,
in denen alle unverheirateten Männer, die "Mats" organisiert waren.
Die Mats übten sich ständig im Umgang mit Waffen und waren für
ihre Streit- und Raublust berüchtigt. In der Heimat hatten sie oft
wegen ihrer Vorliebe für Spiel und Alkohol und konstanten Gewaltbereitschaft
einen schlechten Ruf und viele sahen es nicht ungern, wenn sie in Italien
oder Frankreich für immer verschwanden. Dennoch ruhte die Schweizer
Wehrkraft vor allem auf ihnen. Der Historiker Walter Schaufelberger kommt
deshalb zu dem Urteil, dass das Hauptgewicht des Krieges "auf allen ruhelosen,
unzufriedenen, ja asozialen Elementen aus minderem Volke" lastete. Ganz
enorm verstärkt wurde diese Bedeutung noch durch die Möglichkeit,
dass sich wohlhabende Schweizer von ihren Dienstpflichten loskaufen konnten,
indem sie einen Ersatzmann stellten. Das heißt: der Fremdendienst
wurde oft durch eine Art internen Söldnerdienst vorbereitet. Viele
Bürger ließen sich durch arme Hirten oder nachgeborene Bauernsöhne
beim Wachdienst und vor allem bei Kriegszügen vertreten. In den Städten
handelte es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern die Regel. So
sollen zur Zeit der Burgunderkriege von 157 Luzernern nur 33 aus Luzern
selbst gewesen sein.
Der Söldnerdienst ging neben dieser Ausdehnungspolitik ungehindert
weiter; man kann sogar sagen, dass sich beide Momente wahrscheinlich verstärkten.
Die unruhigen und kriegserfahrenen Reisläufer, die "Kriegsgurgeln"
bildeten das Rückgrat der Volksaufgebote, und je mehr die Schweiz
expandierte und an Selbstvertrauen gewann, desto mehr Bauernsöhne
betrachteten den Kriegsdienst als Broterwerb. Obwohl in der Not auch gut
situierte Bürger und Bauern mit den Aufgeboten auszogen, dominierten
die Kriegsgurgeln. Ihr wichtigstes Rekrutierungsreservoir waren die Jungmännerbünde,
in denen alle unverheirateten Männer, die "Mats" organisiert waren.
Die Mats übten sich ständig im Umgang mit Waffen und waren für
ihre Streit- und Raublust berüchtigt. In der Heimat hatten sie oft
wegen ihrer Vorliebe für Spiel und Alkohol und konstanten Gewaltbereitschaft
einen schlechten Ruf und viele sahen es nicht ungern, wenn sie in Italien
oder Frankreich für immer verschwanden. Dennoch ruhte die Schweizer
Wehrkraft vor allem auf ihnen. Der Historiker Walter Schaufelberger kommt
deshalb zu dem Urteil, dass das Hauptgewicht des Krieges "auf allen ruhelosen,
unzufriedenen, ja asozialen Elementen aus minderem Volke" lastete. Ganz
enorm verstärkt wurde diese Bedeutung noch durch die Möglichkeit,
dass sich wohlhabende Schweizer von ihren Dienstpflichten loskaufen konnten,
indem sie einen Ersatzmann stellten. Das heißt: der Fremdendienst
wurde oft durch eine Art internen Söldnerdienst vorbereitet. Viele
Bürger ließen sich durch arme Hirten oder nachgeborene Bauernsöhne
beim Wachdienst und vor allem bei Kriegszügen vertreten. In den Städten
handelte es sich dabei nicht um Einzelfälle, sondern die Regel. So
sollen zur Zeit der Burgunderkriege von 157 Luzernern nur 33 aus Luzern
selbst gewesen sein.
Es war ein wildes, archaisches Kriegertum, das seine passende Ausdrucksform
im "Gewalthaufen" fand. In diesen gewaltigen Menschenblöcken waren
die ersten Glieder mit dem bis fünf Meter langen Langspieß bewaffnet.
Ihre Aufgabe bestand hauptsächlich darin, den Ansturm der gepanzerten
Reiter abzuwehren, weshalb zunehmend darauf geachtet wurde, dass eine Mindestzahl
mit dieser eigentlich unpopulären Waffe ausgerüstet war. Denn
die große Masse bevorzugte die Halmbarte (Halm mit Bart), aus der
später die Hellebarte wurde. In Untersuchungen wurde nachgewiesen,
dass Spieß und Armbrust aber auch Harnische bei den Schweizern äußerst
unbeliebt waren. Sie waren schlecht im Nahkampf zu verwenden und behinderten
bei der Verfolgung und beim Beutemachen. Es gab immer wieder Klagen der
Tagsatzung (des Parlaments), dass viele Krieger ihre Harnische und Spieße
zu Hause gelassen hatten. Manchmal musste den Aufgeboten dann die die notwendige
Ausrüstung hinterher geschickt werden, um zumindest die ersten Glieder
entsprechend zu bewaffnen. Die eigentliche Stärke war aber der Massendruck
des manchmal bis zu 50 Mann tiefen Gewalthaufens. und hier lag auch der
grundlegende Unterschied zu anderen mittelalterlichen Fußaufgeboten.
Anders als diese beschränkten sich die Schweizer nicht darauf, die
Reiter abzuwehren, sondern gingen selbst in einem alles vernichtenden Sturmlauf
vor.
1339 schlugen sie bei Laupen erstmals in einer offenen Feldschlacht
ein Ritterheer. Zu einem ganz großen Erfolg wurde dann 1386 die Schlacht
bei Sempach, in der sie sogar die abgesessen kämpfenden Ritter der
Habsburger überrannten. Kurz darauf folgte der Sieg bei Näfels.
1444 wurde zwar ein kleines Schweizer Aufgebot von den Armagnacs - ebenfalls
ein Söldnertrupp aus Frankreich - bei St. Jakob an der Birs vernichtet,
bereitete seinen Gegnern aber so schwere Verluste, dass diese möglichst
schnell abzogen. Die phänomenalen Siege der Burgunderkriege waren
so gesehen nur eine weitere Etappe auf einem längst beschrittenen
Weg. Man sollte deshalb auch hier nicht geblendet vom Glanz der großen
Schlachten die relativ konstante Entwicklung nicht aus den Augen verlieren.
Nach Sempach weiteten die Schweizer ihr Gebiet konsequent auf Kosten der
Habsburger aus bis diese völlig aus der Schweiz vertrieben waren.
Danach folgten Vorstöße über den St. Gotthard nach Italien
und das Tessin wurde erobert. Der Zusammenstoß mit Burgund im Elsass
und im Waadt waren letztlich nur eine Konsequenz dieser Expansionspolitik.
Aber auch der Fremdendienst hatte sich konstant weiter entwickelt. Bereits
vor den Burgunderkriegen dienten große Gruppen Schweizer Söldner
bei verschiedenen Fehden im Reich, in Savoyen, Frankreich und Italien.
1465 standen sie sogar im Sold Karls des Kühnen gegen Frankreich.
Danach kam das Geschäft allerdings richtig in Schwung. Die immense
Beute, die in den Burgunderkriegen gemacht worden war, war der beste
Werber. Viele Heimkehrer warfen mit Geld nur so um sich und prahlten
mit ihren Heldentaten. So gab es mehr als genug Freiwillige, die bereit
waren auf ähnliche Weise ihr Glück zu machen. Alle Versuche der
Behörden das Reislaufen zu verbieten - inzwischen machte man sich
Sorgen, zu viele Krieger zu verlieren - erwiesen sich als nutzlos. Bald fand man
Schweizer in kleinen Gruppen oder als ganze Abteilungen in fast allen Kriegen
Westeuropas. Zum Großabnehmer entwickelte sich aber Frankreich, das
bald so regelmäßig Truppen in der Schweiz mietete, dass es den
Aufbau einer eigenen Infanterie sehr lange vernachlässigte. Im Dienst
Frankreichs kamen die Schweizer nach Italien, das sich am Beginn der Neuzeit
zum Zankapfel der Großmächte entwickelte und dadurch für
Jahrzehnte zum Experimentierfeld neuer Techniken und Taktiken wurde. Als
Söldner erlebten die Schweizer dort einige ihre größten
Triumphe aber auch einige ihrer bittersten Niederlagen. Vor allem aber
wurden die Kriege um Italien zu einem wichtigen Wendepunkt der Schweizer
Söldnergeschichte, da dort sowohl das wilde Reisläufertum wie
auch die bislang dilettantische aber ungehemmte Außenpolitik der
Kantone in ihre Grenzen verwiesen wurden.
 Am Ende des Mittelalters war Italien weiterhin in eine ganze Anzahl
autonomer Herrschaften zerteilt - u.a. Mailand, Venedig, Florenz, der Kirchenstaat,
Neapel. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass dieses fragile Gebilde auswärtige
die neuen großen Territorialstaaten geradezu zur Intervention einlud,
sobald diese ihre Macht konsolidiert hatten. Als erster erschien Karl VIII.
von Frankreich auf der Bühne und machte Erbansprüche auf Neapel
geltend. Die Stärke des französischen Heeres waren wie in Burgund
die gepanzerten Gens d’armes der Ordonanzkompanien und die mächtige
Artillerie. Um das Fußvolk war es dagegen viel schlechter gestellt.
Man warb zwar Schützen und Spießen in der Gascogne und der Picardie,
doch die waren bestenfalls für Hilfsaufgaben zu gebrauchen. Da die
Bedeutung des Fußvolks inzwischen jedoch nicht mehr ignoriert werden
konnte, ließ Karl VIII. 1494 insgesamt 10.000 Schweizer anwerben,
die dadurch etwa ein Fünftel seiner Truppen stellten.
Am Ende des Mittelalters war Italien weiterhin in eine ganze Anzahl
autonomer Herrschaften zerteilt - u.a. Mailand, Venedig, Florenz, der Kirchenstaat,
Neapel. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass dieses fragile Gebilde auswärtige
die neuen großen Territorialstaaten geradezu zur Intervention einlud,
sobald diese ihre Macht konsolidiert hatten. Als erster erschien Karl VIII.
von Frankreich auf der Bühne und machte Erbansprüche auf Neapel
geltend. Die Stärke des französischen Heeres waren wie in Burgund
die gepanzerten Gens d’armes der Ordonanzkompanien und die mächtige
Artillerie. Um das Fußvolk war es dagegen viel schlechter gestellt.
Man warb zwar Schützen und Spießen in der Gascogne und der Picardie,
doch die waren bestenfalls für Hilfsaufgaben zu gebrauchen. Da die
Bedeutung des Fußvolks inzwischen jedoch nicht mehr ignoriert werden
konnte, ließ Karl VIII. 1494 insgesamt 10.000 Schweizer anwerben,
die dadurch etwa ein Fünftel seiner Truppen stellten.
Diesem mächtigen Heer waren die Condottieri der italienischen Stadtstaaten
in keiner Weise gewachsen, und falls doch einmal eine Festung Widerstand
zu leisten wagte, wurden ihre mittelalterlichen Mauern in kürzester
Zeit zusammengeschossen. Das ganze Unternehmen war militärisch eine
Art Spaziergang, bei dem die Franzosen und ihre Schweizer Söldner
unerwartet reiche Beute machten. Der schnelle französische Erfolg
hatte jedoch nur das Resultat, dass sich alle anderen Parteien - der Papst,
Venedig, Mailand, Spanien und Habsburg - zusammenschlossen und die Franzosen
zu einem überstürzten Rückzug zwangen. Damit war die lange
Reihe der "Italienischen Kriege" eröffnet, die erst 1559 mit dem Frieden
von Cateau-Cambrésis zum Abschluss kommen sollten. Die außergewöhnlich
lange Dauer ergab sich deshalb, da sich ständig neue Allianzen der
Schwächeren gegen den jeweils stärksten bildeten. Die Schweizer
wurden dabei sehr schnell zur von allen Seiten umworbenen Eliteinfanterie,
da es lange keine Mittel gab den Ansturm ihrer Gewalthaufen zu stoppen.
Um den Schweizern eine vergleichbare Infanterie entgegenstellen zu können
hatte Kaiser Maximilian mit der Aufstellung der Landsknechte begonnen,
bei denen es sich in Taktik und Ausrüstung um eine Art Kopie der Schweizer
handelte. Obwohl die Landsknechte ihren Vorbildern lange nicht gewachsen
waren, so waren sie doch die einzigen, die man diesen entgegen stellen
konnte. Deshalb warben sogar die Franzosen Landsknechte in großer
Zahl als sie selbst mit den Schweizern aneinander gerieten. Diese so genannten
Schweizerschlachten, der erbarmungslose Zusammenprall zwischen den Spieße
starrenden Gewalthaufen von Landsknechten und Schweizern, gehören
dann auch zu den grausamsten Gemetzeln der Söldnergeschichte.
Als sich aber Schweizer und Landsknechte in fremdem Dienst in Italien
abschlachteten, gehörten beide bereits zu einer ausklingenden Epoche,
standen beide noch mit ihrer Wildheit und ihrem Brauchtum mit zumindest
einem Fuß im Mittelalter. Die neue Zeit, deren militärische
Grundlagen hauptsächlich in Italien erprobt wurden, gehörte dem
Zusammenspiel verschiedener Waffengattungen. 1513 hatten die Schweizer
die Landsknechte in französischem Sold noch einfach überrannt.
Bereits zwei Jahre später mussten sie jedoch bei Marignano eine schwere
Niederlage hinnehmen. Die französischen Gens d’armes hatten durch
verlustreiche Flankenangriffe der Schweizer immer wieder gestoppt, so dass
es den Landsknechten gelang die gut verschanzte Hauptlinie mit den Geschützen
zu halten. Nach zwei Tagen blutigen Ringens zogen die Schweizer ab. Franz
I. ließ sie ziehen, denn er wusste, er würde sie noch brauchen.
Neue Einsichten setzen sich unter sieggewohnten Truppen nur schwer durch,
und so lernten auch die Schweizer nicht viel. Ein englischer
Militärhistoriker bezeichnet den Konservatismus der Schweizer sogar als
"ein unverzeihliches Verbrechen" im Krieg. Aber was war schon eine Niederlage
nach all den zahllosen Siegen; das nächste mal würden sie einfach
noch energischer angreifen, sagten sie sich. 1522 war es dann so weit.
Die Schweizer standen jetzt wieder in französischem Sold den kaiserlichen
Landsknechten und Spaniern bei Bicocca gegenüber. Da die Kaiserlichen
eine gut verschanzte Stellung hielten, wollte der französische Marschall
Lautrec mit dem Angriff warten. Doch die Schweizer wollten endlich die
Entscheidungsschlacht, um dann mit Sold und Beute nach Hause zu ziehen.
Nachdem Lautrec ihren Drohungen nachgegeben hatte, begannen sie mit ihrem
üblichen Angriff, dabei wurden sie aber von den spanischen Arkebusieren
furchtbar dezimiert und anschließend von den Landsknechten in den
vor der Stellung liegenden Hohlweg zurückgetrieben. Drei Jahre später
bei Pavia ergriffen sie sogar vor den Landsknechten auf freiem Feld die
Flucht. Aber auch Pavia war nicht durch Landsknechte, sondern die gelungene
Zusammenarbeit zwischen Artillerie, Schützen, Reiterei und Infanterie
entschieden worden.
Vor allem in deutschen Geschichtsbüchern kann man immer wieder
lesen die Landsknechte seien bei Bicocca und Pavia mit ihren Lehrmeistern
gleichgezogen oder hätten sie gar als überlegen erwiesen. Das
ist eindeutig falsch. Während der Hugenottenkriege (1547-89) trafen
Schweizer und Landsknechten noch oft genug aufeinander, ohne dass sich
die Letzteren als ernst zu nehmende Gegner erwiesen hätten. Doch zu
dieser Zeit hatten die Schweizer bereits viel von ihrer anarchischen Wildheit
verloren und konnten keine Schlachten mehr allein entscheiden; sie dienten
als Eliteinfanterie im Verbund des französischen Heeres.
Die Italienischen Kriege führten aber neben den zahlreichen militärischen
Neuerungen noch zu einem politischen Umbruch in der Schweiz, der für
den Fremdendienst entscheidend sein sollte. Der lose Staatenbund hatte
wie gesagt auch eine relativ erfolgreiche Expansionspolitik betrieben und
sein Territorium auf Kosten der Habsburger und Burgunds erweitert. Bereits
im frühen 15. Jahrhundert hatten die Schweizer dann auch damit begonnen
über die Alpen ins Tessin vorzustoßen, waren dort aber von Mailand
zurückgeschlagen worden. Nachdem der Kampf um Italien dann im großen
Stil begonnen hatte, war es deshalb nicht erstaunlich, dass die Schweizer
auch wieder eigene, "nationale" Interessen verfolgten. Nach größeren
Eroberungen im Tessin, besetzten sie 1511 sogar Mailand und wurden so zum
Gegner Frankreichs. Unter gewissen Umständen wäre es zu dieser
Zeit vielleicht möglich gewesen, dass sich die Schweiz als europäische
Großmacht mit Häfen am Mittelmeer etabliert hätte. Doch
dazu war die Schweiz letzten Endes viel zu anarchisch, zu föderalistisch.
Während der ganzen Zeit warben die Abgesandten Frankreichs, Habsburgs
und des Papstes in der Schweiz mit viel Geld für ihre jeweilige Sache.
Konnte sich die Tagsatzung also tatsächlich einmal zu einem Kriegszug
durchringen, so hieß das noch lange nicht, dass alle Schweizer mitzogen
oder im Feld blieben. Vor Marignano ließen sich viele Schweizer Hauptleute
von den Franzosen bestechen und zogen mit ihren Kontingenten nach Hause.
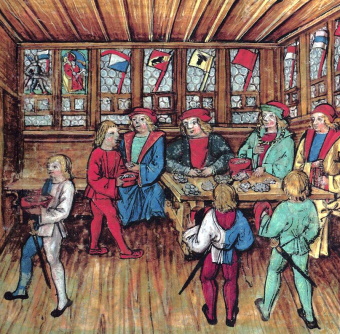 Wenn ihre Heimat bedroht war, eilten die Schweizer immer mit Begeisterung
zu den Fahnen. Zog sich ein Feldzug jedoch in die Länge, häuften
sich sehr schnell die Schwierigkeiten. Unterschleif und Geldgier der schweizerischen
Heeresversorger waren berüchtigt und wurde wahrscheinlich von kaum
einem anderen Staat übertroffen. Ein Großteil der politischen
Entscheidungsträger, die Räte, Vögte und Ortsvorsteher verdienten
seit langem hervorragend an den Pensionen und Geldgeschenken ausländischer
Mächte, um im Gegenzug Werbungen zu erlauben. Es gab zwar immer wieder
Versuche, das "wilde" Reislaufen zu unterbinden und in feste Bahnen zu
lenken. Doch die einfachen Knechte und auch viele Hauptleute scherten sich
wenig darum. Schließlich hatten sie auch gute Gründe dafür
anzunehmen, dass die Großen ihnen das Reislaufen nur verbieten wollten,
weil sie das Geld von der anderen Seite eingestrichen hatten. In der Schweiz
hatten ganze Generationen mit dem Krieg glänzende Geschäfte gemacht
und Korruption durchzog die Führungsschichten wie ein Krebsgeschwür.
Auch als schließlich der Reformator Zwingli gegen den Fremdendienst
wetterte, hatte dies nur den Erfolg, dass er sich zahlreiche Feinde in
den Urkantonen machte, die ja um ihre Pfründen fürchten mussten,
so dass diese streng katholisch blieben.
Wenn ihre Heimat bedroht war, eilten die Schweizer immer mit Begeisterung
zu den Fahnen. Zog sich ein Feldzug jedoch in die Länge, häuften
sich sehr schnell die Schwierigkeiten. Unterschleif und Geldgier der schweizerischen
Heeresversorger waren berüchtigt und wurde wahrscheinlich von kaum
einem anderen Staat übertroffen. Ein Großteil der politischen
Entscheidungsträger, die Räte, Vögte und Ortsvorsteher verdienten
seit langem hervorragend an den Pensionen und Geldgeschenken ausländischer
Mächte, um im Gegenzug Werbungen zu erlauben. Es gab zwar immer wieder
Versuche, das "wilde" Reislaufen zu unterbinden und in feste Bahnen zu
lenken. Doch die einfachen Knechte und auch viele Hauptleute scherten sich
wenig darum. Schließlich hatten sie auch gute Gründe dafür
anzunehmen, dass die Großen ihnen das Reislaufen nur verbieten wollten,
weil sie das Geld von der anderen Seite eingestrichen hatten. In der Schweiz
hatten ganze Generationen mit dem Krieg glänzende Geschäfte gemacht
und Korruption durchzog die Führungsschichten wie ein Krebsgeschwür.
Auch als schließlich der Reformator Zwingli gegen den Fremdendienst
wetterte, hatte dies nur den Erfolg, dass er sich zahlreiche Feinde in
den Urkantonen machte, die ja um ihre Pfründen fürchten mussten,
so dass diese streng katholisch blieben.
Da die Reisläufer in dieser Hierarchie ganz weit unten rangierten
und fast kontinuierlich betrogen wurden, hatten sie nicht allzu viele Gründe
mehr als unbedingt notwendig im Feld zu bleiben. Nach siegreichen Schlachten,
vor allem wenn gute Beute gemacht worden war verlief sich manchmal das
ganze Heer. Die Reisläufer waren dann einfach nicht mehr zu führen
und gingen nach Hause. Wenn sie dennoch Versprechungen oder Drohungen nachgaben,
wurden sie meistens durch ausbleibende Versorgung und unterschlagenen Sold
eines besseren belehrt. Zentrale Institutionen um solche Missbräuche
abzustellen oder zumindest einzuschränken gab es praktisch keine.
Eines besonders peinliches Beispiel war der so genannte "Verrat
von Novara". Kurz vor 1500 hatten vor allem die antifranzösischen
Kräfte in der Schweiz geworben. Der vertriebene Herzog von Mailand
Ludovico Sforza genannt "il Moro" warb sogar 11.000 Schweizer und verjagte
mit ihrer Hilfe die Franzosen aus Mailand. Nachdem aber der französische
König Ludwig XII. viel Gold in der Schweiz verteilt hatte, gestattete
man ihm 24.000 Mann anzuwerben. Mit diesen belagerte er dann Ludovico Sforza
in Novara. Dessen Schweizer wollten sich nun mit ihren zahlenmäßig
überlegenen Landsleuten nicht schlagen und übergaben die Stadt
gegen freien Abzug. Ludovico Sforza hatten sie zwar versprochen, ihn verkleidet
aus der Stadt zu bringen, lieferten ihn dann aber doch an Ludwig aus, der
ihn in einem französischen Kerker sterben ließ. So ein offenkundiger
Verrat war natürlich geschäftsschädigend und so kam es in
der Schweiz zu einer großen Untersuchung. Obwohl es sicher viele
Schuldige gab, beschränkte man sich schließlich aber darauf
einen zu enthaupten.
Am Beginn der Neuzeit, die sie ja mit eingeläutet hatten, fehlte
es den Schweizern nicht an militärischer Schlagkraft aber an den politischen
Institutionen, um sich auf eine einheitliche Außenpolitik festzulegen
und diese dann auch durchzusetzen. Sie blieben deshalb ein loser Staatenbund,
der eigentlich erst durch seine gegebene Armut und das Unvermögen, sich auf eine
gemeinsame Außenpolitik zu einigen, in die Lage kam, seine Söhne zu
seinem Hauptexportartikel zu machen. Diese Situation lässt sich sehr gut
mit dem klassischen Griechenland vergleichen. Auch dort hatten sich tapfere
Volksaufgebote in spektakulären Freiheitskriegen - gegen Persien - einen
ausgezeichneten Ruf als Kämpfer erworben. Da es jedoch nicht gelang,
gemeinsame staatliche Institutionen zu schaffen, wurden die Griechen
für Generationen zu den wichtigsten Söldnerlieferanten der Antike.
Es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass Griechen und Schweizer
ausgerechnet in der Phalanx die ihnen angemessene Form des Kampfes fanden.
