Söldner im Dreißigjährigen Krieg
Der alltägliche Kampf ums Überleben.
 Das Negativbild des Söldners in der deutschen Geschichte wurde fast
ausschließlich während des Dreißigjährigen Kriegs
geprägt. Werden den Landsknechten des 15. Jahrhunderts oft noch wild-romantische
Züge abgewonnen, und gelten die Söldner des Absolutismus meistens
als armes, verschachertes Schlachtvieh, so scheinen sich in denen des Dreißigjährigen
Krieges alle schlechten Eigenschaften zu vereinen: Brutalität, Raublust,
Profitgier gepaart mit Illoyalität und der ständigen Bereitschaft
bei besserer Bezahlung die Seiten zu wechseln. Doch gerade die Landsknechte
waren nicht nur für Plünderungsorgien, Disziplinlosigkeit und
Meutereien berüchtigt, sondern auch dafür, für jede Partei,
die bezahlen konnte, zu kämpfen. Der Hauptursache des schlechten Rufs
der Söldner des Dreißigjährigen Krieges ist sicher darin
zu sehen, dass sie ihre Untaten hauptsächlich in Deutschland verübten.
Die Landsknechte haben dagegen im kollektiven Gedächtnis Italiens
und Frankreichs ähnliche Spuren hinterlassen; der "Landsquenet" wurde
dort zu einem Synonym für Plünderungen und Ausschreitungen einer
zügellosen Soldateska.
Das Negativbild des Söldners in der deutschen Geschichte wurde fast
ausschließlich während des Dreißigjährigen Kriegs
geprägt. Werden den Landsknechten des 15. Jahrhunderts oft noch wild-romantische
Züge abgewonnen, und gelten die Söldner des Absolutismus meistens
als armes, verschachertes Schlachtvieh, so scheinen sich in denen des Dreißigjährigen
Krieges alle schlechten Eigenschaften zu vereinen: Brutalität, Raublust,
Profitgier gepaart mit Illoyalität und der ständigen Bereitschaft
bei besserer Bezahlung die Seiten zu wechseln. Doch gerade die Landsknechte
waren nicht nur für Plünderungsorgien, Disziplinlosigkeit und
Meutereien berüchtigt, sondern auch dafür, für jede Partei,
die bezahlen konnte, zu kämpfen. Der Hauptursache des schlechten Rufs
der Söldner des Dreißigjährigen Krieges ist sicher darin
zu sehen, dass sie ihre Untaten hauptsächlich in Deutschland verübten.
Die Landsknechte haben dagegen im kollektiven Gedächtnis Italiens
und Frankreichs ähnliche Spuren hinterlassen; der "Landsquenet" wurde
dort zu einem Synonym für Plünderungen und Ausschreitungen einer
zügellosen Soldateska.
Die Situation der Söldner hatte sich im 17. Jahrhundert grundlegend
geändert. Die Neuerungen kamen hauptsächlich aus den Niederlanden,
wo der lange Unabhängigkeitskrieg gegen das übermächtige
Spanien Reformen zuerst erzwungen und dann beschleunigt hatte. Nach vielen
Niederlagen versuchten die Niederländer als erste, einen neuen Weg
einzuschlagen. Unter Moritz von Oranien begannen sie Ende des 16. Jahrhunderts
mit einer Heeresreform, die für die abendländische Kriegskunst
vorbildlich werden sollte. Ausgangspunkt war die regelmäßige
Bezahlung. Dafür konnte Disziplin und Gehorsam verlangt werden. Man
gewöhnte die Söldner aber nicht nur an das bislang unbekannte
Exerzieren, sondern nötigte sie auch zum Schanzen. Kein Landsknecht
hatte vorher eine Schaufel in die Hand genommen. Diese Arbeit war etwas
für die verachteten Schanzgräber und eines richtigen Kriegsmannes
unwürdig. In den Niederlanden galt fortan das Motto: "Graben spart
Blut". Festungsbau und Belagerungstechniken wurden zu regelrechten Wissenschaften.
Bislang hatten die Schützen die Spießerhaufen als Plänkler
mit einem unregelmäßigen Feuer unterstützt. Jetzt wurden
Musketiere in mehreren Gliedern aufgestellt und darauf gedrillt, Salven
abzugeben. Neben dem Ausbildungsstand erhöhte Moritz von Oranien auch
die Zahl der Vorgesetzten; aus den Doppelsöldnern, die auf dem ersten
Blatt der Musterliste geführt wurden, wurde die "Prima Plana" - der
Offiziersstand. Die Feuerwaffen wurden effektiver und Musketiere ersetzten
immer mehr die Spießer und Hellebardenträger. Die alten Gewalthaufen
verschwanden zu Gunsten flacherer, beweglicherer Einheiten, die auf ihre
Feuerkraft an Stelle des Massendrucks setzten.
Ein weiterer wichtiger Unterschied war die verlängerte Dienstzeit.
Landsknechte waren zuvor oft nur für die Dauer eines Feldzuges von
einigen Monaten angeworben und dann wieder entlassen worden. Während
des Krieges in den Niederlanden war dann die Dienstzeit immer weiter verlängert
worden. Die Söldner dienten nun meistens viele Jahre. Eine Entwicklung
die durch den Dreißigjährigen Krieg weiter verstärkt wurde.
Hatten sich Söldner früher auf einen zeitlich begrenzten Kriegszug
begeben, wie ja das schweizer Wort "Reisläufer" verdeutlicht, so wurden
sie nun zu dauerhaft Entwurzelten, deren eigentliche Heimat das Regiment
war. Im Tross mit seinen Garküchen, Händlern und Prostituierten
wuchs der Anteil an Familienangehörigen. Dabei wurde er zu einer Dauerinstitution,
und übertraf in seinem Umfang die Zahl der Kombattanten bald um ein
Vielfaches.
Mit steigendem Finanzaufkommen wurde aber nicht nur die Dienstzeit verlängert,
sondern auch die Heeresstärken selbst stetig gesteigert. Wallenstein
schaffte es dann als erster eine 100.000-Mann-Armee aufzustellen. Diese
gewaltigen Truppenmassen über Jahre mit Ausrüstung und Nahrung
zu versorgen überforderte die logistischen Möglichkeiten jeder
kriegführenden Partei. In diese Lücke drängten nun die hohen
Offiziere als selbständige Unternehmer. Sie organisierten Rekrutierung,
Bewaffnung, Kleidung, Sold und natürlich das Essen der Truppe, und
stellten ihre Ausgaben später ihrem Auftraggeber in Rechnung. Das
reichte von einem Großunternehmer wie Wallenstein, der in seinen
eigenen Ländereien eine richtiggehende Industrie zur Truppenversorgung
aufgebaut hatte, über die Regimentskommandeure bis zu den Hauptleuten,
die für eine bestimmte Summe die Verpflegung ihres Fähnleins
einkauften. Es versteht sich von selbst, dass bei diesem System konstant
betrogen wurde. Unsummen wurden an der Versorgung mit gepanschtem Mehl,
verdorbenem Fleisch, schlechter Kleidung und billigen Waffen verdient.
Beliebt waren auch die "Passe-Volanten"; d.h. für Gestorbene und Deserteure
wurde weiterhin Sold und Kostgeld kassiert, und bei einer Musterung wurden
dann von anderen Truppenteilen Ersatzleute ausgeliehen, die eben wie im
Flug durchgereicht wurden.
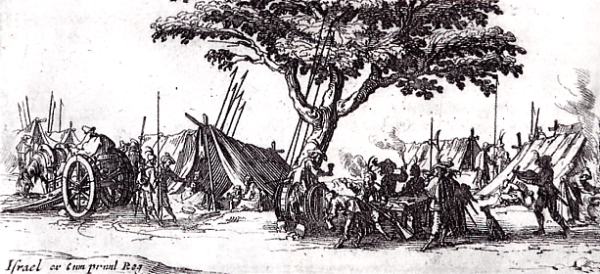
Die eigentlichen Leidtragenden dieses Systems waren natürlich die
einfachen Söldner, an denen jeder verdienen wollte, der in der Hierarchie
über ihnen stand. Obwohl einige der großen Schlachten wirklich
mörderisch waren, erstaunt es deshalb nicht, dass die überwiegende
Anzahl der Söldner Opfer der schlechten Versorgung wurden. Der englische
Historiker Geoffrey Parker spricht sogar vom Zehnfachen der Schlachtverluste!
Allgemein geht die Forschung von einer jährlichen Verlustrate von
25-30% aus. Der überwiegende Anteil der Söldner hatte also entgegen
mancher Vorstellungen höchstwahrscheinlich nie direkt gegen einen
Gegner gekämpft, sondern war irgendwo entlang der Marschstraßen
oder in einem schlechten Winterlager verhungert, erfroren oder einer banalen
Krankheit erlegen. Durch mangelnde Ernährung und schlechte Kleidung
wurden die Truppen besonders anfällig für Seuchen. So soll das
kaiserliche Heer 1620 in Böhmen fast 50% von 27.000 Mann wahrscheinlich
durch Hungertyphus verloren haben. Viele Söldner gingen barfuß,
hatten keine Mäntel und übernachteten in Strohhütten oder
Erdlöchern. Im Winter 1621/22 erfroren viele der schlecht gekleideten
Spanier und Italiener von Spinolas Armee, und Gustav Adolf verlor im Lager
vor Nürnberg über 2/3 seiner Truppen.
Das Elend in manchen Winterlagern übersteigt heute wahrscheinlich
die Vorstellungskraft. Die große Ausnahme war natürlich, wenn
die Truppen bei wohlhabenden Bauern einquartiert wurden oder durch Regionen
kamen, die noch nicht ausgesogen waren. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch
immer schwieriger die Truppen aus dem Land zu versorgen. In der letzten
Phase des Krieges gingen deshalb die Heeresstärken rapide zurück,
und der Anteil der Kavallerie stieg ständig, da nur noch Reiter die
ausgeplünderten Landstriche schnell genug passieren konnten. Der Traum
von reicher Beute war sicher schon immer ein wichtiges Motiv für Söldner
gewesen. Für die des Dreißigjährigen Krieges wurde die
Beute jedoch zu einer reinen Überlebensnotwendigkeit. Der Sold lag
mit durchschnittlich 8-10 Gulden zwar zwischen dem Verdienst eines Hilfsarbeiters
und dem eines Handwerksmeisters. Allerdings wurde er oft unregelmäßig
oder gar nicht bezahlt. Zudem mussten die Söldner im Feldlager fast
alles zu überhöhten Preisen kaufen. Viele hatten außerdem
Frau und Kinder oder zumindest einen Buben. Man sollte das aus heutiger
Sicht nicht für überflüssigen Luxus halten. Irgendjemand
musste ja während des Dienstes auf die wenigen Habseligkeiten aufpassen,
Feuer machen, abkochen, ein eventuell vorhandenes Lasttier versorgen und
tausend andere kleine Arbeiten verrichten.
An ein Entrinnen aus dieser Misere war kaum zu denken. Natürlich
gab es immer wieder zahlreiche Deserteure, vor allem wenn der Sold zu lange
ausblieb oder die Versorgungslage katastrophal wurde. Doch wohin sollten
sie gehen, von was leben? Überall gab es Banden verelendeter Bauer,
die Deserteuren auflauerten, um ihnen Sold und Beute abzunehmen. Einzelne
hatten kaum eine Chance durchzukommen, aber die Bauernbanden vernichten
sogar ganze Kompanien. Letzten Endes blieb nur das Überlaufen zum
Gegner. Man entkam zwar nicht dem Krieg, konnte aber vielleicht bessere
Konditionen aushandeln und bekam erneut Handgeld. Dennoch belegen Spezialuntersuchungen,
dass überraschend wenige desertierten. Der Großteil blieb seine
ganze Dienstzeit - manchmal sogar über Jahrzehnte - beim gleichen
Regiment. Einige wechselten notgedrungen die Einheit, wenn ihr altes Regiment
aufgelöst wurde oder wenn sie als Kriegsgefangene "untergesteckt"
wurden.
 Die Veteranen, die bereits im Feuer gestanden hatten, bezeichnete man
als "versuchte" oder "beschossene" Knechte. Sie waren das Rückgrat
jedes Regiments. Jeder Oberst war auf diese alten "Kriegsgurgeln" angewiesen
und war deshalb auch immer bereit, ihnen vieles durchgehen zu lassen. Mit
fatalistischem Gleichmut ertrugen sie die Schrecken der Schlacht und gaben
den jungen Rekruten den notwendigen Rückhalt. Weitaus wichtiger als
ihr routiniertes Verhalten im Kampf war jedoch, dass sie die notwendigen
Überlebensstrategien kannten. Sie fielen beim Marsch nicht zurück,
konnten sich bei leichten Verwundungen und Krankheiten selbst kurieren,
wussten wie man zur Not eine wetterfeste Hütte baute, fanden bei den
Bauern den letzten Sack Getreide und ließen sich von den Marketendern
nicht betrügen.
Die Veteranen, die bereits im Feuer gestanden hatten, bezeichnete man
als "versuchte" oder "beschossene" Knechte. Sie waren das Rückgrat
jedes Regiments. Jeder Oberst war auf diese alten "Kriegsgurgeln" angewiesen
und war deshalb auch immer bereit, ihnen vieles durchgehen zu lassen. Mit
fatalistischem Gleichmut ertrugen sie die Schrecken der Schlacht und gaben
den jungen Rekruten den notwendigen Rückhalt. Weitaus wichtiger als
ihr routiniertes Verhalten im Kampf war jedoch, dass sie die notwendigen
Überlebensstrategien kannten. Sie fielen beim Marsch nicht zurück,
konnten sich bei leichten Verwundungen und Krankheiten selbst kurieren,
wussten wie man zur Not eine wetterfeste Hütte baute, fanden bei den
Bauern den letzten Sack Getreide und ließen sich von den Marketendern
nicht betrügen.
Ein einzigartiges Zeugnis von Alltag und Selbstverständnis eines
solchen Veteranen ist ein 1993 von dem Historiker Jan Peters entdecktes
Tagebuch, in dem ein einfacher Söldner von seinen Erlebnissen zwischen
1625 und 1649 berichtet. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem anonymen
Verfasser um einen gewissen Peter Hagedorf, einen Müllersohn aus der
Gegend von Magdeburg.
Hagedorf wanderte 1625 durch die Schweiz nach Norditalien; ob aus Reiselust,
oder um Arbeit zu suchen, bleibt unklar. Jedenfalls ließ er sich
dort für einige Monate von den venezianischen Truppen anwerben und
nahm an den Kämpfen um das Veltin teil. Danach besuchte er mit einem
Kameraden einige Städte in Norditalien, und nahm etwas später
in Parma erneut Solddienst. Nach anderthalb Jahren machte er sich dann
langsam auf den Heimweg. Nachdem sein Geld zu Ende gegangen war, bettelte
er und erreichte so schließlich Ulm. Von Hunger oder schweren Kämpfen
berichtet er nichts; der Solddienst scheint für ihn mehr eine Möglichkeit
gewesen zu sein, etwas von der Welt zu sehen. Unter diesen Umständen
war es für ihn dann ein selbstverständlicher Schritt, in Ulm
in das Pappenheimsche Regiment von Tillys Armee einzutreten. Damit hatte
er sozusagen den Dreißigjährigen Krieg betreten, wo er für
die nächsten 22 Jahre bleiben sollte.
 Während dieser Zeit nahm er vor allem an den Kämpfen in Süddeutschland
teil, an zahlreichen Belagerungen und Scharmützeln, aber auch an großen
Schlachten wie Lützen oder Nördlingen. Er berichtet zwar chronologisch
von den Märschen, dem Schanzen und den Gefechten, geht dabei aber
nie besonders ins Detail. Man hat "den Feinden zugesetzt" oder "mit Kanonen
auf die Feinde gespielt" und natürlich immer wieder geschanzt. Wie
er sich persönlich dabei geschlagen hat oder ob er gar getötet
hat, erscheint ihm nicht erwähnenswert. Die große politische
Lage oder gar die Religion werden völlig ignoriert. Er dankt zwar
Gott, wenn er wieder einmal Glück gehabt hat, lässt es aber dabei
bewenden. Als er 1633 von den Schweden gefangen und untergesteckt wird,
kämpft er nun genau so professionell gegen kaiserliche und Bayern.
Nach der Niederlage bei Nördlingen kam er dann wieder in sein altes
bayrisches Regiment. Für ihn scheint das absolut keinen Unterschied
gemacht zu haben.
Während dieser Zeit nahm er vor allem an den Kämpfen in Süddeutschland
teil, an zahlreichen Belagerungen und Scharmützeln, aber auch an großen
Schlachten wie Lützen oder Nördlingen. Er berichtet zwar chronologisch
von den Märschen, dem Schanzen und den Gefechten, geht dabei aber
nie besonders ins Detail. Man hat "den Feinden zugesetzt" oder "mit Kanonen
auf die Feinde gespielt" und natürlich immer wieder geschanzt. Wie
er sich persönlich dabei geschlagen hat oder ob er gar getötet
hat, erscheint ihm nicht erwähnenswert. Die große politische
Lage oder gar die Religion werden völlig ignoriert. Er dankt zwar
Gott, wenn er wieder einmal Glück gehabt hat, lässt es aber dabei
bewenden. Als er 1633 von den Schweden gefangen und untergesteckt wird,
kämpft er nun genau so professionell gegen kaiserliche und Bayern.
Nach der Niederlage bei Nördlingen kam er dann wieder in sein altes
bayrisches Regiment. Für ihn scheint das absolut keinen Unterschied
gemacht zu haben.
Wesentlich wichtiger ist ihm dagegen die Versorgungslage. Wenn es in
einem Winterquartier genug Wein gab, findet er das durchaus interessant.
"Diesen Winter habe auch hier Wein genug gehabt, umsonst." Als es einmal
besonders reichlich Nahrung gab schreibt er: "hier haben wir kein Rindfleisch
mehr wollen essen, sondern es haben müssen Gänse, Enten oder
Hühner sein." Während er von seinen ganzen gefallenen Kameraden
bestenfalls einige der Offiziere nennt, erzählt er, dass er einmal
mit einem Vetter sein Pferd versoffen habe. Kampf und Tod waren für
ihn anscheinend derart banale Sachen, dass man darüber nicht viele
Worte verlieren musste, reichlich essen und trinken dagegen nicht. Das
höchste Lob war ganz offensichtlich: "gefressen und gesoffen, dass
es gut heißt."
Natürlich schreibt er auch über Hunger und Teuerung. Mehrmals
notiert er genau, wie viel Brot, Wein oder Fleisch kosten. "Hier ist das
Brot und Fleisch wieder an den höchsten Nagel gehängt worden,
wegen des vielen Volks." Wenn sein Regiment in eine neue Region kommt,
hat er fast immer zuerst ein Auge auf die Landwirtschaft und deren Produkte:
"guter Weinwachs und Kornbau", "guter Wein gewesen" oder "viel Viehzucht
und schöner Kornbau". Man könnte ihm jetzt ein allgemeines Interesse
an Ackerbau und Viehzucht unterstellen, viel wahrscheinlicher ist es jedoch
die Perspektive des Söldners, der sofort bei der Ankunft mit Kennerblick
abzuschätzen beginnt, wie hier wohl die Quartiere sein werden, ob
man hier noch gut leben oder vielleicht sogar richtig prassen kann.
 Dieser alltägliche Überlebenskampf, bei dem es weit mehr ums
Essen als um Heldentaten ging, wird besonders durch die Familienbeziehungen
des Söldners illustriert. Bald nach seinem Eintritt ins Pappenheimsche
Regiment heiratete er zum ersten mal. Mit dieser Frau hatte er vier Kinder,
die alle bereits nach Tagen oder wenigen Wochen starben. Nachdem seine
Frau 1633 ebenfalls gestorben war, hatte er einige Jahre einen Jungen,
der nun die anfallenden Hilfsdienste und Arbeiten erledigen musste. 1635
heiratete er nochmals. Von den fünf Kindern dieser Ehe überlebten
immerhin zwei den Krieg, während die anderen ebenfalls sehr schnell
starben. Die Frauen und der Junge dienten jedoch nicht nur der Bequemlichkeit
des Söldners, indem sich kochten oder wuschen. Sie achteten auf die
Habseligkeiten beim Tross, organisierten Lebensmittel und halfen beim plündern.
Als er selbst schwer verwundet war, lief seine erste Frau unter Lebensgefahr
in das brennende Magdeburg und brachte Bettzeug zum Verbinden, Wein, Kleider
und zwei silberne Gürtel zurück. Der Junge holte einmal aus Heidelberg
eine Kuh. Zudem mussten sie zur Erntezeit anscheinend immer Getreide auf
den Feldern schneiden. Einmal sogar unter dem Geschützfeuer des belagerten
Colmar. Von einer Teuerung berichtet er dann stolz, dass er mit seiner
Frau einen Sack voll Gerste und Roggen gedroschen habe. Anschließend
habe er mit zwei Schleifsteinen das Korn, gemahlen, einen Backofen in die
Erde gegraben und so viel Brot gebacken, dass er noch mit gutem Gewinn
davon verkaufen konnte.
Dieser alltägliche Überlebenskampf, bei dem es weit mehr ums
Essen als um Heldentaten ging, wird besonders durch die Familienbeziehungen
des Söldners illustriert. Bald nach seinem Eintritt ins Pappenheimsche
Regiment heiratete er zum ersten mal. Mit dieser Frau hatte er vier Kinder,
die alle bereits nach Tagen oder wenigen Wochen starben. Nachdem seine
Frau 1633 ebenfalls gestorben war, hatte er einige Jahre einen Jungen,
der nun die anfallenden Hilfsdienste und Arbeiten erledigen musste. 1635
heiratete er nochmals. Von den fünf Kindern dieser Ehe überlebten
immerhin zwei den Krieg, während die anderen ebenfalls sehr schnell
starben. Die Frauen und der Junge dienten jedoch nicht nur der Bequemlichkeit
des Söldners, indem sich kochten oder wuschen. Sie achteten auf die
Habseligkeiten beim Tross, organisierten Lebensmittel und halfen beim plündern.
Als er selbst schwer verwundet war, lief seine erste Frau unter Lebensgefahr
in das brennende Magdeburg und brachte Bettzeug zum Verbinden, Wein, Kleider
und zwei silberne Gürtel zurück. Der Junge holte einmal aus Heidelberg
eine Kuh. Zudem mussten sie zur Erntezeit anscheinend immer Getreide auf
den Feldern schneiden. Einmal sogar unter dem Geschützfeuer des belagerten
Colmar. Von einer Teuerung berichtet er dann stolz, dass er mit seiner
Frau einen Sack voll Gerste und Roggen gedroschen habe. Anschließend
habe er mit zwei Schleifsteinen das Korn, gemahlen, einen Backofen in die
Erde gegraben und so viel Brot gebacken, dass er noch mit gutem Gewinn
davon verkaufen konnte.
Im September 1649 wurde er dann nach dem Frieden von Münster mit
dreifachem Monatssold zu je 13 Gulden abgedankt. Er war nun Mitte bis Ende
Vierzig hatte eine Frau und zwei kleine Kinder und wusste nicht wohin.
Die Aufzeichnungen enden an diesem Punkt und man weiß nicht ob er
versucht hat, im Zivilleben wieder Fuß zu fassen. Wahrscheinlich
suchte er sich wie viele entlassene Söldner einen neuen Krieg. Das
Reich war zwar ausgebrannt, aber der Kampf um die Vorherrschaft in Europa
verlagerte sich damit lediglich an die Peripherie. Bereits vor dem Ende
des Dreißigjährigen Krieges hatte in England der Bürgerkrieg
begonnen, der dann auf Schottland und Irland übergriff. Die Niederländer
kämpften ohne Unterbrechung in Brasilien und in Indonesien. Auch die
Türkei wurde mit dem Überfall auf Kreta wieder an ihrer Westgrenze
aktiv. Kurz darauf entbrannte im Wilden Feld ein Kosakenaufstand gegen
Polen, in den die Türkei, Ungarn, Siebenbürgen, Dänemark,
Schweden und schließlich Russland verwickelt wurden. Frankreich und
Spanien kämpften unentwegt weiter an den Pyrenäen, in Italien
und in Flandern.
In allen diesen Kriegen kamen zahlreiche Söldner aus dem Reich
zum Einsatz. Oft machten sich ganze Regimenter unter ihren alten Obristen
auf den Weg. Doch auch die deutschen Fürsten nutzten bald die Gelegenheit
ihre Länder von den überschüssigen Merodebrüder und
Kriegsgurgeln zu befreien und dafür noch harte Subsidien zu kassieren.
Der Soldatenhandel, den viele mit den "verkauften Hessen" des Unabhängigkeitskrieges
verbinden, hat seine Wurzeln in den überschüssigen Veteranen
des Dreißigjährigen Krieges, die diese Weise gewinnbringend
verkauft wurden. Natürlich handelte es sich bei diesen Söldner
nicht nur um Deutsche. So bestand zum Beispiel ein bayerisches Regiment
gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges aus 534 Deutschen, 217
Italienern, 15 Franzosen, 24 Lothringern, 24 Burgundern, 26 Griechen, 54
Polen, 5 Ungarn, 51 Slowenen, 11 Spaniern, 14 Tschechen, 14 Türken,
18 Dalmatiern, 2 Schotten, 2 Kroaten und jeweils einem Iren und einem Sizilianer.
Ein Venezianer sprach in diesem Zusammenhang deshalb treffend von "Arche-Noah-Armeen".
