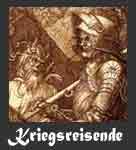Die Schwarze Garde
Der Weg einer der ersten Landsknechtsformationen durch Nordeuropa.
 Die Landsknechte entstanden als eine Art Hausinfanterie der Habsburger. Wenn diese aber
keine Verwendung für sie hatten oder sie nicht bezahlen konnten, suchten sie sich
auf dem "freien Markt" neue Auftraggeber. Die erste selbständige größere Gruppe
von Landsknechten führte ein gewisser Martin Schwarz nach England. Damit steht Schwarz
am Anfang einer langen Reihe von Kriegsunternehmern und Landsknechtsführern, die diesen
neuen Söldnertyp im Reich für fast jeden Auftraggeber anwarben. Wie viele in einem
neuen Gewerbe war er ein typischer Aufsteiger. Der ehemalige Schuster aus Augsburg hatte
sich schon bei der Verteidigung von Neuß ausgezeichnet und war während der folgenden
Kämpfe der Habsburger um die Niederlande von Maximilian zum Ritter geschlagen worden.
Er war also bereits ein erfahrener und bekannter Söldnerführer, als ihn das aus
England vertriebene Haus York anwarb, um den verlorenen Thron zurückzuerobern. Im Auftrag
der englischen Exilanten kam Schwarz mit 2.000 Landsknechten und Schweizern nach Dublin,
wo ein Scharlatan als Richard York zum König gekrönt wurde. In Irland wurden noch
6.000 Iren angeworben, die aber nur mit Schwertern und Wurfspießen bewaffnet waren. Nach der
Landung in England 1487 kam es bei Stoke in der Nähe von Nottingham zur Schlacht mit dem
weit überlegenen englischen Heer. Die Landsknechte griffen im Gevierthaufen an, konnten
aber von den englischen Rittern unter starken Verlusten aufgehalten werden. Währenddessen
wurden die ungepanzerten Iren von den Bogenschützen zusammengeschossen. Nach der Vernichtung
der Iren wurden die Landsknechte von Rittern und Bogenschützen in die Zange genommen und
vollständig aufgerieben. Es war ein kurzes Debüt, aber die Landsknechte waren nicht
wie bisher allgemein üblich vor den Rittern geflohen, sondern hatten Standfestigkeit bewiesen.
Die Landsknechte entstanden als eine Art Hausinfanterie der Habsburger. Wenn diese aber
keine Verwendung für sie hatten oder sie nicht bezahlen konnten, suchten sie sich
auf dem "freien Markt" neue Auftraggeber. Die erste selbständige größere Gruppe
von Landsknechten führte ein gewisser Martin Schwarz nach England. Damit steht Schwarz
am Anfang einer langen Reihe von Kriegsunternehmern und Landsknechtsführern, die diesen
neuen Söldnertyp im Reich für fast jeden Auftraggeber anwarben. Wie viele in einem
neuen Gewerbe war er ein typischer Aufsteiger. Der ehemalige Schuster aus Augsburg hatte
sich schon bei der Verteidigung von Neuß ausgezeichnet und war während der folgenden
Kämpfe der Habsburger um die Niederlande von Maximilian zum Ritter geschlagen worden.
Er war also bereits ein erfahrener und bekannter Söldnerführer, als ihn das aus
England vertriebene Haus York anwarb, um den verlorenen Thron zurückzuerobern. Im Auftrag
der englischen Exilanten kam Schwarz mit 2.000 Landsknechten und Schweizern nach Dublin,
wo ein Scharlatan als Richard York zum König gekrönt wurde. In Irland wurden noch
6.000 Iren angeworben, die aber nur mit Schwertern und Wurfspießen bewaffnet waren. Nach der
Landung in England 1487 kam es bei Stoke in der Nähe von Nottingham zur Schlacht mit dem
weit überlegenen englischen Heer. Die Landsknechte griffen im Gevierthaufen an, konnten
aber von den englischen Rittern unter starken Verlusten aufgehalten werden. Währenddessen
wurden die ungepanzerten Iren von den Bogenschützen zusammengeschossen. Nach der Vernichtung
der Iren wurden die Landsknechte von Rittern und Bogenschützen in die Zange genommen und
vollständig aufgerieben. Es war ein kurzes Debüt, aber die Landsknechte waren nicht
wie bisher allgemein üblich vor den Rittern geflohen, sondern hatten Standfestigkeit bewiesen.
Auf die Spuren eines anderen Trupps von Landsknechten stößt man beim Abwehrkampf des kleinen Ordensstaates Livland gegen das expandierende Großfürstentum Moskau. Daß der Ordensmeister Wolter von Plettenberg sein Ritterheer mit Landsknechten verstärkte, ist nicht weiter erstaunlich. Als er aber 1501 das russische Heer am Smolinasee schlug, kämpften in dessen Zentrum ebenfalls deutsche Landsknechte. Sie drangen tief in die Linien des Ordensheeres ein und konnten erst nach hartem Kampf vernichtet werden. Die Schlachten bei Stoke und am Smolinasee sind inzwischen fast vollständig vergessen. Woher die Knechte kamen und was aus ihren geschlagenen Resten wurde ist unbekannt. Es wird jedoch deutlich, daß schon am Ende des 15. Jahrhunderts kaum ein Krieg zu unbedeutend oder zu abgelegen war, als daß nicht eine Schar von Landsknechten ihr Glück dabei gesucht hätte.
Sowohl zeitlich wie auch geographisch zwischen diesen beiden Ereignissen stößt man auf die Geschichte der sogenannten "Großen" oder "Schwarzen Garde", über die wesentlich mehr bekannt ist, da sie weitaus erfolgreicher im Dienst verschiedener Herren über ein Jahrzehnt die Länder an Nord- und Ostsee verheerte.
Die Große Garde war aus einem Zusammenschluß verschiedener Söldnertruppen am Niederrhein entstanden, wo sich Habsburg, Frankreich, Städte und Fürsten um die burgundische Erbmasse schlugen. Es lag im Interesse der Landsknechte und ihrer Hauptleute auch nach Beendigung einer dieser zahllosen Fehden zusammenzubleiben und sich einen neuen Auftraggeber zu suchen. Bei größeren Unternehmungen schlossen sich mehrere Gruppen zusammen. In der Not suchten sie sich verschiedene Auftraggeber und fanden sich dann auch manchmal in feindlichen Lagern. Am besten war es allerdings geschlossen aufzutreten. Nur als große Gruppe konnte man gute Konditionen aushandeln und die kurzen Friedensperioden durch Raub und Erpressung überstehen.
 Den Kern der Garde bildete eine Truppe von Landsknechten, die von Maximilian in Flandern aufgestellt worden war. Es kann also gut sein, daß auch Schwarz
aus ihren Reihen hervorgegangen ist und die bei Stoke vernichteten Knechte eine ihrer Splittergruppen waren. Ein anschauliches Bild aus dieser Anfangsphase
vermittelt die zeitgenössische Biographie des fränkischen Ritters Wilwolt von Schaumburg. Wilwolt hatte als "Küriser", das heißt als schwerer Reiter, unter Karl
dem Kühnen und dann als Landsknechtsführer unter Maximilian gedient. Sein Biograph schildert ihn zwar noch in vielem als fahrenden Ritter und berichtet
ausführlich vom Leben am Hof, Festen, Turnieren und großartigen Schlachten, doch andererseits erkennt man schon den neuen Typus des Söldnerführers,
der Krieg führte, um Gewinn zu machen. Als zum Beispiel ein Überfall auf das reiche Dinant in Brabant gelang, stellt er zufrieden fest, daß Wilwolt "auch desmal
ein redliche gute beut, die ob fünf zehen hundert gülden wert" gemacht hatte. Aber auch die Beute der einfachen Knechte wird hervorgehoben: "Der fuesknecht
einer, der unter her Wilwolten von Schaunburg was, gewan in eins Lumbarten (Lombarden=Geldwechsler) haus 1600 barer gülden, verspilt die aber desselben
tags und all sein gelt darzue, das er auf den abend das mall nit zu bezallen; bat seiner gesellen einen, im das gölch darzu leihenn. Der antwort, solt er hungers
sterben, er lihe ime nimmer pfening. Darbei zu erkennen, was glaubens in den fuesbuben sei. Hans Meztzger der profos, was ein armer knecht, vieng einen abt in
der stat, gab ime zwelf tausent gülden zu schatzung (als Lösegeld)." Nach diesem gelungenen Raubzug blieb das Heer noch acht Tage in der Stadt, damit jeder
in Ruhe seine Beute tauschen, verkaufen oder an einen sicheren Ort schicken konnte.
Den Kern der Garde bildete eine Truppe von Landsknechten, die von Maximilian in Flandern aufgestellt worden war. Es kann also gut sein, daß auch Schwarz
aus ihren Reihen hervorgegangen ist und die bei Stoke vernichteten Knechte eine ihrer Splittergruppen waren. Ein anschauliches Bild aus dieser Anfangsphase
vermittelt die zeitgenössische Biographie des fränkischen Ritters Wilwolt von Schaumburg. Wilwolt hatte als "Küriser", das heißt als schwerer Reiter, unter Karl
dem Kühnen und dann als Landsknechtsführer unter Maximilian gedient. Sein Biograph schildert ihn zwar noch in vielem als fahrenden Ritter und berichtet
ausführlich vom Leben am Hof, Festen, Turnieren und großartigen Schlachten, doch andererseits erkennt man schon den neuen Typus des Söldnerführers,
der Krieg führte, um Gewinn zu machen. Als zum Beispiel ein Überfall auf das reiche Dinant in Brabant gelang, stellt er zufrieden fest, daß Wilwolt "auch desmal
ein redliche gute beut, die ob fünf zehen hundert gülden wert" gemacht hatte. Aber auch die Beute der einfachen Knechte wird hervorgehoben: "Der fuesknecht
einer, der unter her Wilwolten von Schaunburg was, gewan in eins Lumbarten (Lombarden=Geldwechsler) haus 1600 barer gülden, verspilt die aber desselben
tags und all sein gelt darzue, das er auf den abend das mall nit zu bezallen; bat seiner gesellen einen, im das gölch darzu leihenn. Der antwort, solt er hungers
sterben, er lihe ime nimmer pfening. Darbei zu erkennen, was glaubens in den fuesbuben sei. Hans Meztzger der profos, was ein armer knecht, vieng einen abt in
der stat, gab ime zwelf tausent gülden zu schatzung (als Lösegeld)." Nach diesem gelungenen Raubzug blieb das Heer noch acht Tage in der Stadt, damit jeder
in Ruhe seine Beute tauschen, verkaufen oder an einen sicheren Ort schicken konnte.
Bei dieser einträglichen Art der Kriegführung erstaunt es nicht, daß die Landsknechte wenig Lust hatten, nach Hause zu gehen - falls sie diese Möglichkeit überhaupt hatten - als Maximilian die Niederlande verließ und sie damit ohne Arbeit waren. Sie blieben zusammen und wählten Neidhart Fuchs zu ihrem Anführer. Dieser wußte Rat: Da der Herzog von Geldern mit Maximilian verfeindet war, zogen sie einfach in dessen Land und raubten und plünderten dort. Um sein Land zu schützen oder weil keine bessere Truppe zur Hand war, nahm sie der Herzog von Geldern selbst in Sold und führte sie gegen Jülich und Cleve. Bei den Kämpfen in Geldern im Jahr 1494 werden sie dann erstmals von einem Chronisten als Große Garde bezeichnet: "In derselben Zeit, als Nijkerk erobert wurde, hat auch in diesen Gegenden eine große Konzentration von Kriegsvolk stattgefunden, das vier, fünf oder mehr Männer gewählt hatte, denen es unterstand. Zu ihnen schlug sich allerlei Volk, Reiter und Fußknechte, verdorbene Priester und Mönche und auch Weiber, Welsche und Deutsche, und sie wurden genannt die Große Garde. Sie schonten weder Fremde noch Freunde und verheerten alles, was in ihre Nähe kam." Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen taucht neben Neidhart Fuchs auch der Junker Thomas Slentz als einer ihrer wichtigsten Hauptleute auf.
In Friesland warb dann Dänemark Teile der Garde, um die rebellischen Schweden wieder zu unterwerfen. Sie setzten 1497 nach Schweden über und schlugen das Bauernaufgebot Sten Stures bei Rotebro nördlich von Stockholm. Nach ihrer Rückkehr kamen sie unter ihren Hauptleuten Fuchs und Slentz wieder in Friesland zum Einsatz. Von dort wandten sie sich frei plündernd nach Süden, fanden aber schnell wieder neue Auftraggeber. Bald waren sie wieder in Friesland. Sie erlitten Verluste durch Gefechte und Krankheiten, manchmal wurden kleinere Gruppen von Bauern nieder gemacht oder dem Henker übergeben. Aber sie erhielten ausreichend neuen Zulauf. In ihren Reihen standen Oberdeutsche, Friesen, Niederländer, Lombarden, Spanier, Schweizer, Engländer, Schotten und sogar einigen Mauren.
Es war nicht leicht einen solchen wilden und bunt gemischten Haufen zu führen. Immer wieder gab es Streit um die Beute und um den ausbleibenden Sold. Ganz besonders schwierig konnte es werden, dieses aufrührerische Volk in den Kampf zu führen, wenn es dort nichts zu gewinnen, selbst aber einiges zu verlieren hatte. Als Wilwolt zum Beispiel seine Knechte zu einem Ausfall aus einer Stadt, in der sie wohlversorgt mit Beute und Frauen lagen, bewegen wollte, mußte er feststellen: "Die Weinwirt, Metzger, Hurnführer und ander gros Hansen wollten nit auf, hetten Sorg, die in der Stat mochten ihnen den Cramschatz nemen oder die Hurn nützen. [...] Saßen auf iren Erschen still." Wilwolt mußte sein Unternehmen nicht nur abbrechen, sondern in der Stadt dann auch noch die Frauen beruhigen, die einen Aufruhr angezettelt hatten, da sie fürchteten, er wolle ihre Männer in den Tod führen. Von den Hauptleuten, Fähnrichen und Weibeln schob "einer die schult auf den andern". Wie alle guten Kriegsleute dachten die Landsknechte erst einmal an sich und ihren Besitz, und dabei hatten die Troßangehörigen offensichtlich ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Wenn sie Beute und Einkommen in Gefahr sahen, schreckten sie auch vor Verschwörungen mit dem Feind nicht zurück. Wilwolts Biograph berichtet von einem solchen "Judasrat". Als das friesische Groningen kurz vor der Kapitulation stand, trafen sich einige Abgesandte der Großen Garde mit Landsknechten aus der belagerten Stadt. Sie sagten sich: "Wir sint kriegsleut. Solt der herzog die stat mit gwalt oder tädung (durch Übergabe) gewinnen, so ist sonst allenthalben im lant fride, mochten nit dienst bekommen und müsten wieder bossen rais laufen (übel umherziehen). Wo aber der herzog die stat nit erobert, würden sie zu beiden teilen leut bedurfen". Nachdem die Landsknechte den Friesen die heimliche Unterstützung von Teilen der Garde zugesichert hatten, wurde die Kapitulation abgelehnt und der Krieg ging weiter.
 Wenn es allerdings zum Kampf kam, mußten sie sich ihren Sold sauer verdienen. Die Friesen waren tapfere Gegner und nutzten geschickt Sümpfe und Kanäle
zur Verteidigung. Auf Deichen und um Schleusen konnte es zwischen den Spieße starrenden Gewalthaufen zu blutigen Gemetzeln kommen. Wilwolts Biograph
überliefert davon ein recht anschauliches Bild. Als Neidhart Fuchs mit seinem Fähnlein von einer groninger Übermacht gestellt wurde, stieg er wie alle
Hauptleute vom Pferd, legte seine Rüstungen bis auf Krebs (Brustpanzer) und Goller (Halsschutz) ab und stellte sich zwischen die einfachen Knechte ins
erste Glied. "Sie tratten zu hauff, und Fuchs knecht stachen die Grünigerischen ir knecht drei glider bis an das vorder fendlein darnieder. Aber lieber got,
der hauf was zu groß, sprungen zu beiden seiten zu Fuchs fendlein, stachen sie zum weichen, und wart Neidhart mit einer büchsen geschoßen, das er viele.
Als bald der lag, fluhen sein knecht dahin, und woliche bei im bliben, wurden erstochen und vil wurden in si gehauen".
Wenn es allerdings zum Kampf kam, mußten sie sich ihren Sold sauer verdienen. Die Friesen waren tapfere Gegner und nutzten geschickt Sümpfe und Kanäle
zur Verteidigung. Auf Deichen und um Schleusen konnte es zwischen den Spieße starrenden Gewalthaufen zu blutigen Gemetzeln kommen. Wilwolts Biograph
überliefert davon ein recht anschauliches Bild. Als Neidhart Fuchs mit seinem Fähnlein von einer groninger Übermacht gestellt wurde, stieg er wie alle
Hauptleute vom Pferd, legte seine Rüstungen bis auf Krebs (Brustpanzer) und Goller (Halsschutz) ab und stellte sich zwischen die einfachen Knechte ins
erste Glied. "Sie tratten zu hauff, und Fuchs knecht stachen die Grünigerischen ir knecht drei glider bis an das vorder fendlein darnieder. Aber lieber got,
der hauf was zu groß, sprungen zu beiden seiten zu Fuchs fendlein, stachen sie zum weichen, und wart Neidhart mit einer büchsen geschoßen, das er viele.
Als bald der lag, fluhen sein knecht dahin, und woliche bei im bliben, wurden erstochen und vil wurden in si gehauen".
Letzten Endes waren die Friesen aber der überlegenen Kriegstechnik der Fürsten und dem Terror der Garde nicht gewachsen; sie mußten sich unterwerfen. Wilwolt übernahm andere Aufgaben, aber die Landsknechte blieben unbeschäftigt zurück. Im Winter 1499 lagen sie unter der Führung von Thomas Slentz ohne Sold südlich der Elbe und litten wie berichtet wird "große Not und großen Hunger". In dieser Situation waren die Abgesandten des Dänenkönigs Johann willkommen, die sie zu einem Feldzug gegen die reiche Bauernrepublik Dithmarschen anwerben wollten. Die Dithmarscher hatten bereits mehrere Ritteraufgebote der Holsteiner vernichtend geschlagen und damit ähnlich wie die Schweizer ihre Freiheit über Jahrhunderte gewahrt. Seit Holstein allerdings dänisches Lehen geworden war, sahen sie sich der Übermacht dieses ganz Skandinavien umfassenden Königreichs gegenüber. Nachdem der Aufstand in Schweden niedergeschlagen war, wollte König Johann nun auch die kleine Bauernrepublik unterwerfen. Er hatte allerdings aus den Niederlagen seiner Vorgänger gelernt und wollte sich nicht allein auf den Adel stützen, sondern vor allem die im Kampf gegen rebellische Bauern bestens bewährte Garde einsetzen.
Diese bezeichnete sich jetzt auch manchmal als "Schwarze Garde", was vielleicht darauf zurückgeht, daß Wilwolt einmal alle Knechte in schwarzem und weißem Tuch hatte einkleiden lassen, das er als Soldzahlung erhalten hatte. Auf jeden Fall pflegte die Garde ihren neuen Beinamen, da sie dadurch unter ihren Gegnern noch mehr Schrecken zu verbreiten hoffte. Wie viele Söldnertruppen setzte sie den Terror gezielt als Waffe ein. Sie hatte meistens gegen Bauern- oder Stadtmilizen gekämpft und dabei war es bereits der halbe Sieg, wenn der Gegner bei ihrem Anmarsch den Mut verlor. Ein dithmarscher Chronist schrieb: "sie hatten so bekannte Namen und einen mächtigen Ruhm, daß man vor diesem Volk erschrak, wenn man nur seinen Namen hörte. Weil man es für ein unüberwindliches Volk hielt, das greulich Raub, Mord und Brand ausübte. Sie verwüsteten die Städte und das Land, verschonten weder Kirchen noch Klöster. Sie gingen erbärmlich und unchristlich mit den Leuten und Gefangenen um, verschonten keinen Stand oder Geschlecht". Lange bevor es zum Kampf kam erzählten sich die Bauern schon Schauergeschichten von der gnadenlosen und unbesiegbaren Garde. Und wenn es dann so weit war, sahen sie den schwarzen Gewalthaufen mit einem Wald von Spießen auf sich zurücken, die Trommeln dröhnten dumpf und die Garde stimmte ihren Schlachtruf an: "Wahre di Bure, de Garde de kumbt."
Der Feldzug sollte im Winter stattfinden wenn das Moor und die vielen Wassergräben gefroren und passierbar waren. Anfang Februar rückte das dänische Heer über die trockene höher gelegene Geest auf Meldorf, den Hauptort des Landes vor. Die Garde bestand aus 16 Fähnlein mit zusammen gut 4.000 Mann; der dänische und holsteinische Adel war mit 2.000 Berittenen erschienen; hinzu kam noch die Landwehr mit 5.000 bewaffneten Bauern, zahlreiche Geschütze und ein gewaltiger Troß von an die 1.000 Wagen mit Knechten, Fuhrleuten und Dienern. Diesem Heer konnten die Dithmarscher lediglich 6.000 Bauern und einige wenige Geschütze entgegenstellen, zudem mußten sie ihr Aufgebot verteilen, da sie nicht wußten, welchen Weg der Feind wählen würde.
Angesichts der Übermacht räumten die Dithmarscher die hoch liegende Geest und gaben Meldorf auf. Ein Großteil der Bevölkerung war geflohen, nur Alte, Kranke, Kinder und einige Unbelehrbare waren zurückgeblieben. Die Garde begann sofort damit die Dörfer und Bauernhöfe zu plündern. Am Massaker an der Zivilbevölkerung beteiligten sich alle: Holsteiner, Dänen und die Garde. Selbst die an die grausamen Kriege der Zeit gewöhnten Chronisten waren entsetzt. Einer schrieb erschüttert von "Herodianischer Tyrannei". Säuglinge wurden ihren Mütter entrissen, erstochen, auf den Spießen herumgetragen und an Mauern zerschmettert. Der Adel, vor allem der holsteinische haßte diese Bauern, die sich gegen die gottgewollte Ordnung aufgelehnt und ihm schon zwei blutige Niederlagen bereitet hatten. Man wollte sich rächen und ein Exempel statuieren. Im Großen Bauernkrieg in Süddeutschland sah man ähnliche Szenen in weit größerem Ausmaß. Man erkennt aber auch die Handschrift der Garde, die mit solchen Methoden unter ihren Gegnern Furcht und Schrecken verbreiten wollte.

Während das dänische Heer sich in Meldorf austobte, setzte Tauwetter ein. Einige der Führer, so auch Slentz, rieten zum Aufschub. Doch viele dürstete es nach der Beute und der König wollte seine teuren Hilfstruppen möglichst bald entlassen können. Am 17. Februar begann bei Hagel und Schneeregen der Weitermarsch nach Hemmingstedt. Der Weg dorthin führte auf einem Dammweg durch die sumpfige von Gräben durchzogene Marsch. Die Spitze bildete die Garde, ihr folgte die Landwehr, dann kam die Reiterei und am Schluß wühlten sich die Wagen durch den inzwischen knietiefen Morast. Der Troß hatte Meldorf noch nicht ganz verlassen, als die Garde kurz vor Hemmingstedt auf einen Graben und eine Schanze stieß, die die Bauern quer über den Weg gezogen hatten.
Von der Schanze schlug ein vernichtendes Geschützfeuer in die dichten Reihen der Garde. Doch die alten Veteranen waren so leicht nicht zu erschüttern. Sie begannen mit Spießen, Schanzkörben und Brettern die Gräben zu überbrücken, und Slentz ließ einige Geschütze in Stellung bringen. Während sich die Kanoniere damit abmühten im Regen ihre Lunten zu entzünden, unternahmen die Dithmarscher einen Ausfall gegen die Geschütze, der aber an den Spießen der Garde scheiterte. Erst in einem zweiten Anlauf gelang es den Bauern in die Reihen der Garde einzudringen und die Geschütze in die Gräben zu stürzen. Die Landsknechte brauchten Raum, um sich für den Angriff aufstellen zu können. Das war jedoch nicht einfach. Die Bauern hatten die Schleusen geöffnet und das Wasser war am steigen. In Sturm und Regen donnerten die Geschütze, brüllten die Verwundeten, die Kämpfenden und die Hauptleute. Trotz dieses zunehmenden Chaos gelang es Slentz rechts der Straße einen Gewalthaufen zu formieren, um die Schanze zu umgehen. Die Bauern auf der Schanze sahen die Gefahr aber sie kannten auch die Schwierigkeiten und Tücken des teilweise überfluteten Geländes. Sie legten Harnische, Helme und sogar Schuhe ab und stürzten sich halb nackt auf die Garde, die zwischen den Gräben versuchte Ordnung in ihre Reihen zu bringen. Zweimal stürmten sie verzweifelt gegen die von Spießen starrende Phalanx und wurden zurückgeschlagen. Doch da trafen Verstärkungen ein, die andere Straßen besetzt gehalten hatten. Jetzt mehrere tausend Mann stark rannten sie noch einmal gegen die Garde an. Slentz trieb sein Pferd nach vorne, um seine Männer zusammenzuhalten, da riß ihn der lange Reimer von Wimmerstedt mit der Hellebarde samt seinem Pferd um. Da er die Rüstung nicht durchstoßen konnte setzte er ihm die Hellebarde auf die Brust und trat sie mit dem Fuß durch den Panzer.

Einige Kompanien der Garde waren bereits völlig aufgerieben und die meisten ihrer Hauptleute gefallen. Dazu stieg das Wasser und die Landfremden konnten die Gräben nicht mehr erkennen. Die Dithmarscher benützten ihre Spieße als Springstöcke und setzten zielsicher über die tückischen Untiefen. Von allen Seiten drangen sie auf die Söldner ein mit dem leicht veränderten Schlachtruf der Garde: "Wahre di Garde, de Bure de kumbt". Bald lösten sich deren Reihen auf und die Landsknechte begannen zu fliehen. Sie stolperten den schmalen Deichweg zurück und bahnten sich mit Gewalt einen Weg durch die Landwehr, die sofort von der Panik angesteckt wurde und ebenfalls floh. Doch weiter hinten stauten sich die festgefahrenen Wagen bis weit nach Meldorf hinein. Man fuhr sie in die Gräben oder stürzte sie um. Dazwischen standen die dänischen und holsteinischen Ritter, die vom Kampf bisher nur entferntes Donnern und Geschrei vernommen hatten. Verzweifelt versuchten sie die Flüchtenden aufzuhalten, waren aber noch mehr damit beschäftigt in dem Chaos und Schlamm auf ihren Pferden zu bleiben. Doch bald fielen von allen Seiten die Dithmarscher über sie her. Zuerst hielten sich diese an die Losung "schone den Man, schlae de Pferde", um reiche Gefangene zu machen. Aber beim Anblick des Adels in seiner ganzen Pracht, kam der alte Haß wieder hoch und man gab die Losung weiter "schlae den Mann, schone der Pferde." Die Ritter konnten sich nicht wehren. Wer nicht rechtzeitig sein Pferd wendete und sich den Weg freihauen konnte, fand ein ruhmloses Ende. Pardon wurde nicht gegeben, selbst die nackten, ausgeplünderten Leichen wurden noch verstümmelt. Wie groß der Haß der Bauern war, ist auch daran zu ersehen, daß die Leichen des Adels später als Fraß für die Hunde und Raben liegengelassen wurden, während die der Knechte beerdigt wurden.
Die Niederlage war vollkommen. Nur mit Mühe rettete der König sein Leben und die Reste seines Heeres. Allerdings war die Garde nicht, wie oft berichtet wird, vernichtet worden. Angesichts des blutigen Kampfes und des katastrophalen Rückzuges waren ihre Verluste mit etwa 800 Mann sogar relativ gering. Das lag daran, daß bei dem weit auseinandergezogenen Aufmarsch wahrscheinlich nur sechs Fähnlein ins Gefecht kamen. Diese verloren aber über die Hälfte ihrer Mannschaften und alle Hauptleute. Die anderen Fähnlein schafften einen geschlossenen Rückzug und gliederten die Versprengten bei sich ein. Schlimmer als die Verluste war, daß die Garde ihren Nimbus als unbesiegbare Elitetruppe verloren hatte. Die Schwarze Garde hörte mit Hemmingstedt auf zu existieren; ihre Teile aber suchten sich neue Kriege.
Das Gros kämpfte bald wieder in Friesland. Andere zogen 1502 im dänischen Heer wieder gegen die aufständischen Schweden. Bald fand man im Norden die Landsknechte in jedem Krieg und bei jeder Partei. Denn auch die Schweden verstärkten bald ihre Aufgebote mit Landsknechten. In diesen Feldzügen verloren sich die Spuren der Fähnlein und einzelnen Söldner. Wo Geld und Beute versprochen wurden kamen sie zusammen, zerstreuten sich anschließend wieder und traten in andere Verbände ein. Es ist deshalb gut möglich, daß ehemalige Veteranen der Schwarzen Garde auch über Polen oder Nowgorod in den Dienst des Großfürstentums Moskau gekommen waren, um dann am Smolinasee ihr Ende zu finden. Andere verschlug es wohl nach Italien, wo bald die "Schwarzen Banden" von sich reden machten.
© Frank Westenfelder