Der Zauber Ostindiens
Der Kolonialdienst in der VOC.
 Nachdem die Niederländer im Dauerkonflikt mit Spanien einige erste
Handelsexpeditionen zu den Gewürzinseln in Ostindien geschickt hatten,
beschlossen sie ihre Unternehmungen dort zu bündeln und gründeten
1602 die OIC (Oost-Indische Compagnie), aus der dann später die VOC
(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) wurde. Während WIC ihre Kräfte
in einem permanenten Krieg um Pernambuco verschliss, machte die VOC in
Ostindien bessere Geschäfte. Hier war es den Niederländern gelungen
sich nach und nach ein riesiges Imperium zusammenzurauben. Das dazu notwendige
Menschenmaterial konnte nur zum Teil im eigenen Land angeworben werden,
da die relativ kleine Bevölkerung auch auf den Werften und in den
Kontoren gebraucht wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts verfügte die
VOC über 200 Großschiffe mit mehr als 30.000 Mann Besatzung.
In den zerstreuten Garnisonen lagen ständig 8-15.000 Söldner,
und vor allem die weiten Seereisen forderten einen hohen Tribut. Ständig
gingen Schiffe durch Sturm oder Krieg verloren, noch mehr dezimierten Krankheiten
die Mannschaften. Im Durchschnitt lag die Todesrate bei einem Transport
nach Ostindien bei 10%, oft jedoch weit darüber. So waren zum Beispiel
von den 600 Mann, die 1616 zu einer Erkundungsfahrt um die Erde aufgebrochen
waren, nur 53 zurückgekommen.
Nachdem die Niederländer im Dauerkonflikt mit Spanien einige erste
Handelsexpeditionen zu den Gewürzinseln in Ostindien geschickt hatten,
beschlossen sie ihre Unternehmungen dort zu bündeln und gründeten
1602 die OIC (Oost-Indische Compagnie), aus der dann später die VOC
(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) wurde. Während WIC ihre Kräfte
in einem permanenten Krieg um Pernambuco verschliss, machte die VOC in
Ostindien bessere Geschäfte. Hier war es den Niederländern gelungen
sich nach und nach ein riesiges Imperium zusammenzurauben. Das dazu notwendige
Menschenmaterial konnte nur zum Teil im eigenen Land angeworben werden,
da die relativ kleine Bevölkerung auch auf den Werften und in den
Kontoren gebraucht wurde. Gegen Ende des Jahrhunderts verfügte die
VOC über 200 Großschiffe mit mehr als 30.000 Mann Besatzung.
In den zerstreuten Garnisonen lagen ständig 8-15.000 Söldner,
und vor allem die weiten Seereisen forderten einen hohen Tribut. Ständig
gingen Schiffe durch Sturm oder Krieg verloren, noch mehr dezimierten Krankheiten
die Mannschaften. Im Durchschnitt lag die Todesrate bei einem Transport
nach Ostindien bei 10%, oft jedoch weit darüber. So waren zum Beispiel
von den 600 Mann, die 1616 zu einer Erkundungsfahrt um die Erde aufgebrochen
waren, nur 53 zurückgekommen.
In Ostindien kam es zwar auch zu Kämpfen mit Portugiesen und Eingeborenen,
aber Fieber, Malaria, Beriberi, Ruhr, Totschlag und Militärstrafen
forderten weitaus höhere Opfer. Selbst in relativ friedlichen Zeiten
ergab sich daraus ein enormer Menschenverschleiß. Im 17. Jahrhundert
wurden 317.800 Mann nach Asien geschickt; nur 114.400 kamen zurück.
Weit über die Hälfte davon waren Ausländer, wovon die Deutschen
den Löwenanteil stellten. Der Anteil der Franzosen und Engländer
war schon deshalb zurückgegangen, da diese mit eigenen
Flotten nach Asien vorstießen. Außerdem führten beide
mehrere Kriege gegen Holland, wodurch Werbungen immer wieder untersagt
wurden. Weiterhin dienten in der VOC viele Flamen, Skandinavier und Polen.
Das ideale Hinterland war für Holland aber weiterhin das Reich. Aus
Friesland, Holstein und den Hansestädten kamen erprobte Seeleute;
Hessen, Pfälzer und Elsässer nutzten die gute Schiffsverbindung
auf dem Rhein, aber das ferne Indien verlockte auch erstaunlich viele Süddeutsche
aus Nürnberg, Schwaben und Bayern dazu ihr Glück in Amsterdam
zu versuchen.
Der Dienst in Ostindien unterschied sich in vielem von dem in Brasilien.
Man versuchte zwar auch hier den Portugiesen einzelne Schiffe und Forts
abzunehmen, kämpfte sonst aber eher selten gegen europäische
Truppen. An der langen reichen Küste Indiens und Ceylons, im chinesischen
Meer und im weiten indonesischen Archipel zerstreuten sich die Flotten
der Kolonialmächte. Da die asiatischen Staaten in der Regel dicht
bevölkert und relativ hoch entwickelt waren, konnten die Kolonialmächte
anfangs nur kleinere Inseln erobern oder mußten sich auf Handelsniederlassungen
beschränken. Für die Söldner der WIC war der Seetransport
oft das Interessanteste gewesen, in Brasilien hatte dann der Krieg schnell
die exotischen Reize erstickt. In Ostindien bestand der Dienst dagegen
oft aus Seereisen. Truppen wurden von Batavia nach Ceylon, Indien, auf
die Molukken, nach Sumatra oder eine andere der zahllosen Inseln geschickt.
Im lockeren aber weiten Machtbereich der VOC gab es unendlich viel Fremdes
zu sehen und zu entdecken, und so trieben Reiselust und die Hoffnung auf
schnelle Reichtümer weiterhin zahllose Abenteurer auf die holländischen
Schiffe.

Viele kamen aus Städten und besaßen eine gewisse Bildung.
Sie hatten Reiseberichte gelesen und waren entschlossen ihre Jugendträume
zu verwirklichen. Natürlich wollten auch sie reich werden, aber es
waren meistens recht nebelhafte Vorstellungen von märchenhaften Schätzen
und Bergen aus Gold. Einer hatte sogar gehört, daß man Hammer
und Meißel mit nach Indien nehmen sollte, um die Diamanten "von den
Klippen zu kriegen". In ihrer Vorstellungswelt war der ferne Osten eine
fantastische Welt, eine Mischung aus Marco Polo und 1001 Nacht, wo barbarische
Könige, deren Schatzkammern mit Perlen und Juwelen gefüllt waren,
auf Thronen aus Elfenbein und Lapislazuli saßen. In den Krieg zogen
sie hoch auf einem Elefanten, und wenn sie getötet wurden, warfen
ihre Witwen Edelsteine ins Volk, um sich dann auf den brennenden Scheiterhaufen
zu stürzen. Ein Schreiber aus Leipzig berichtet er habe "an der Frantzösischen
Reise-Sucht kranck darnieder gelegen" und sei deshalb mit einem Freund
nach Paris aufgebrochen. Auf einem Hamburger Schiff trafen sie einen Söldner,
der bereits in Ostindien gewesen war. Dieser predigte ihnen so lange von
"Croesischen Schätzen" und "güldenen Bergen" bis sie ihre Pläne
änderten und sich in Amsterdam anwerben ließen. Dem Nürnberger
Patriziersohn Johann Sigmund Wurffbain dagegen hatten seine Eltern geraten,
das Ende des Dreißigjährigen Krieges in Ostindien abzuwarten.
Er wurde nur Söldner, weil man ihm eine Stelle als Kaufmann in Aussicht
gestellt hatte. Da er aus einer wohlhabenden Familie kam, empfand er Strapazen,
Verpflegung und Disziplin als unzumutbar und kam zu dem Schluß: Es
"wird niemand aus Fürwitz oder frembder Lust, sondern vielmehr aus
Mangel der Nahrung, oder ungebürlichen Ursachen, sich unterstehen,
für einen Soldaten bey den Engelländern, Portugiesen und Holländern,
Dienst zu nehmen". Er riet seinen Lesern solche Reisen lieber auf eigene
Kosten zu unternehmen. Aber wer hatte schon das Geld dazu? Für viele
blieb der Kriegsdienst die einzige Möglichkeit aus ihrer engen Heimat
auszubrechen.
Der Weg war meistens der gleiche. Man meldete sich in Amsterdam bei
den Rekrutierungsbüros der VOC und wurde gemustert. Das hieß
man verpflichtete sich in der Regel für fünf Jahre und erhielt
Waffen, eine Seekiste, Bettzeug und Handgeld, mit dem Kleidung und Zusatzverpflegung
gekauft werden konnte, das aber viele gleich im Hafen vertranken. Wurde
gerade keine Flotte zusammengestellt, mußte man warten, entweder
auf eigene Kosten oder im Haus eines Seelenverkäufers, eines "Zeelverkoopers"
wie sie genannt wurden. Diese nahmen stellenlose Seeleute und Söldner
bei sich auf, verköstigten sie und verkauften sie dann bei Bedarf
an Kapitäne, Reeder oder die VOC. Die Unkosten und der nicht unbeträchtliche
Gewinn des Seelenverkäufers wurden später vom Sold abgezogen.
 Nach der Musterung wurden die Söldner mit kleineren Schiffen nach
Texel gebracht, wo die Flotten nach Ostindien ablegten. Mit der Seereise
begann dann für viele die Ernüchterung. Oft drängten sich
drei- bis vierhundert Mann auf dem Zwischendeck. Gesunde, Verlauste und
Kranke lagen dicht an dicht. Jeweils sieben Mann bildeten eine Back und
erhielten in einer gemeinsamen Holzschüssel ihr Essen. Es gab Gerstengrütze,
Bohnen, Erbsen, Stockfisch und Salzfleisch, dazu erhielt jeder wöchentlich
eine Ration Zwieback und am Anfang der Fahrt mehrere kleine Hartkäse.
Außerdem besaß jeder eine Kanne für die tägliche
Wasserration, zu der manchmal auch etwas Branntwein und am Anfang der Fahrt
auch Bier kamen. Wasser war immer knapp und wurde strenger rationiert bei
widrigen Winden oder wenn der Kapitän aus Eile auf Zwischenstationen
verzichtete. Nach einigen Wochen begann das Wasser zu stinken und in den
Fässern schwammen weiße Würmer. Einige Söldner berichten,
daß sie es immer durch ein Tuch siebten und nur mit zugehaltener
Nase trinken konnten. Das Essen war zwar nahrhaft, aber es gab genug Kapitäne,
die mit dem Ankauf von verdorbenem Proviant ihr Gehalt aufbesserten oder
den dafür vorgesehenen Lagerraum zum Teil für eigene Handelsware
benutzten. Konnte mit diesem Essen ein Gesunder immerhin auf bessere
Zeiten hoffen, so war es für Kranke oft tödlich. Es war schwer
verdaulich, viel zu salzig und enthielt keinerlei Vitamine. Die meisten
Opfer forderte dann auch der Skorbut, der sogenannte "Scharbock", gefolgt
von Ruhr, Dysenterie, Blattern, Wassersucht und diversen Tropenkrankheiten.
Nach der Musterung wurden die Söldner mit kleineren Schiffen nach
Texel gebracht, wo die Flotten nach Ostindien ablegten. Mit der Seereise
begann dann für viele die Ernüchterung. Oft drängten sich
drei- bis vierhundert Mann auf dem Zwischendeck. Gesunde, Verlauste und
Kranke lagen dicht an dicht. Jeweils sieben Mann bildeten eine Back und
erhielten in einer gemeinsamen Holzschüssel ihr Essen. Es gab Gerstengrütze,
Bohnen, Erbsen, Stockfisch und Salzfleisch, dazu erhielt jeder wöchentlich
eine Ration Zwieback und am Anfang der Fahrt mehrere kleine Hartkäse.
Außerdem besaß jeder eine Kanne für die tägliche
Wasserration, zu der manchmal auch etwas Branntwein und am Anfang der Fahrt
auch Bier kamen. Wasser war immer knapp und wurde strenger rationiert bei
widrigen Winden oder wenn der Kapitän aus Eile auf Zwischenstationen
verzichtete. Nach einigen Wochen begann das Wasser zu stinken und in den
Fässern schwammen weiße Würmer. Einige Söldner berichten,
daß sie es immer durch ein Tuch siebten und nur mit zugehaltener
Nase trinken konnten. Das Essen war zwar nahrhaft, aber es gab genug Kapitäne,
die mit dem Ankauf von verdorbenem Proviant ihr Gehalt aufbesserten oder
den dafür vorgesehenen Lagerraum zum Teil für eigene Handelsware
benutzten. Konnte mit diesem Essen ein Gesunder immerhin auf bessere
Zeiten hoffen, so war es für Kranke oft tödlich. Es war schwer
verdaulich, viel zu salzig und enthielt keinerlei Vitamine. Die meisten
Opfer forderte dann auch der Skorbut, der sogenannte "Scharbock", gefolgt
von Ruhr, Dysenterie, Blattern, Wassersucht und diversen Tropenkrankheiten.
In fast allen Reiseberichten sind die Seereisen auch gleichzeitig Chroniken
des alltäglichen Sterbens an Bord. Viele der Kranken waren zu schwach,
um sich zu bewegen und lagen apathisch in Urin, Eiter und Erbrochenem,
in Hitze und Gestank des Zwischendecks. Man wußte zwar noch nichts
von Vitaminen, hatte aber die Erfahrung gemacht, daß frische Nahrung
den meisten Kranken half. Deshalb versuchte man nach Möglichkeit auf
den Kanaren oder Kapverden Früchte und frisches Wasser zu laden. Klügere
Kapitäne ließen Zitronen in Fässer einlegen und dann an
die Mannschaft ausgeben. Aber wirklich schlimm wurde es in der windstillen
Region am Äquator. Dort lagen die Schiffe oft wochenlang fest und
in der mörderischen Hitze wurde das Zwischendeck zur Hölle. Ein
Söldner schreibt, daß es selbst nachts noch heißer als
in einer "Badstuben" zu Hause war. Einige verloren vor Durst und Hitze
den Verstand und sprangen über Bord. Für Schiffe, die lange am
Äquator festgelegen hatten, war die Insel St. Helena manchmal die letzte
Rettung. Danach kam das Kap der guten Hoffnung, das seinen Namen erhalten
hatte, da nun das schlimmste vorbei war. Im indischen Ozean waren die Winde
besser und man legte den Weg nach Batavia meistens in einer Etappe und mit weit
geringeren Verlusten zurück.
Doch nicht nur Krankheiten dezimierten die Mannschaften. Enge, Hitze,
Verzweiflung, Langeweile und schlechte Verpflegung förderten Gewalt
und Aggressionen. Bei Söldnern und Matrosen saßen die Messer
locker. Ein falsches Wort und es kam beim Essen und vor allem beim Spiel
zu Streit, Schlägereien und Totschlag. Natürlich waren solche
Dinge schon immer typisch für das Zusammenleben von Söldnern,
aber im Mittelalter berichten nur wenige Chronisten ganz allgemein davon
und auch die Landsknechte schrieben lieber von ihren Heldentaten. Durch
die zahlreichen Reiseberichte wird dieses vage Bild nun deutlicher. Fast
jeder, der auf den Schiffen der VOC fuhr, schreibt über Diebstahl,
Gewalt und Messerstechereien. Da sich an Karten- und Würfelspielen
um Geld der meiste Streit entzündete, waren diese streng verboten,
harmlose Brettspiele wie Dame dagegen erlaubt. Doch die Söldner ließen
sich dadurch nur bedingt von ihrer großen Leidenschaft abhalten.
So schreibt einer, daß der Profos vor allem deshalb verhaßt
war, da er nachts über das Deck schlich und lauschte, ob heimlich
gespielt wurde. Er und seine Genossen verstopften deshalb alle Löcher
mit Matratzen und planten, im Falle einer Entdeckung den Profos zu überwältigen
und über Bord zu werfen. Um trotzdem die Disziplin aufrecht zu erhalten,
bediente man sich einer ganzen Reihe barbarischer Militärstrafen.
Gepeitscht wurde schon wegen Lappalien, schlimmer war das Kielholen, wobei
der Verurteilte mehrmals mit einem Seil unter dem Kiel durchgezogen wurde,
was nur wenige überlebten. Für schwere Vergehen gab es die Todesstrafe
in Form von Hängen oder Erwürgen, manche wurden auch in Eisen
geschlossen und erst in der nächsten Garnison verurteilt. Wer im Streit
ein Messer benützte, dem wurde die Hand damit an den Mast genagelt
und er mußte sie selbst losreißen.
 Wenn die Söldner nach den langen Strapazen endlich Java erreichten,
kamen sie in eine fremde, faszinierende Welt. Die Holländer hatten
in einem Krieg gegen den herrschenden Sultan und die konkurrierenden Engländer
das alte Jakarta zerstört und eine völlig neue Stadt errichtet,
die sie nach ihrer Heimat Batavia nannten. Batavia war fast eine holländische
Stadt mit Mauer, Wassergraben, Zugbrücken, Kanälen, breiten gepflasterten
Straßen, mächtigen Kolonialbauten und prächtigen Gärten.
In Batavia flossen die Reichtümer des Imperiums zusammen, hier saß
der Gouverneur und hier war der Knotenpunkt für die weitverzweigten
Handelsrouten. Das Kastell sollte mit seinen vier Bastionen Diamant, Rubin,
Saphir und Perle sowohl Macht wie auch Reichtum der Kompagnie demonstrieren.
In den Straßen drängten sich Holländer, Chinesen, Malaien,
Neger, Inder und Mischlinge aller Rassen. Es gab Sklaven aus dem gesamten
Archipel, aus Bali, Amboina, Macassar, Borneo und Sumatra, dazu solche
aus Bengalen, Ceylon und Madagaskar. Jeder Haushalt besaß Sklaven,
ein einfacher Handwerker manchmal nur ein halbes Dutzend und die Räte
von Indien mehrere hundert. Durch die Menge schoben sich Lastenträger,
Sänften, von Wasserbüffeln gezogene Karren und manchmal ein Elefant.
In den Kontoren und Lagerhäusern stapelten sich Baumwoll- und Leinenstoffe
aus Indien, seidene Tücher aus Persien, Bengalen und China, Zinn aus
Malaysia, chinesisches Porzellan, Tee, Opium, Salpeter, Zucker, Ebenholz
und all die Gewürze Ostasiens: Muskatblüten und -Nüsse,
weißer und schwarzer Pfeffer, Zimt und die heiß begehrten Gewürznelken
von den Molukken. Die Gärten, Marktstände, Buden und Garküchen
waren voll von exotischen Blüten, Früchten, Gerüchen und
Menschen, von denen man in Europa keinerlei Vorstellung hatte.
Wenn die Söldner nach den langen Strapazen endlich Java erreichten,
kamen sie in eine fremde, faszinierende Welt. Die Holländer hatten
in einem Krieg gegen den herrschenden Sultan und die konkurrierenden Engländer
das alte Jakarta zerstört und eine völlig neue Stadt errichtet,
die sie nach ihrer Heimat Batavia nannten. Batavia war fast eine holländische
Stadt mit Mauer, Wassergraben, Zugbrücken, Kanälen, breiten gepflasterten
Straßen, mächtigen Kolonialbauten und prächtigen Gärten.
In Batavia flossen die Reichtümer des Imperiums zusammen, hier saß
der Gouverneur und hier war der Knotenpunkt für die weitverzweigten
Handelsrouten. Das Kastell sollte mit seinen vier Bastionen Diamant, Rubin,
Saphir und Perle sowohl Macht wie auch Reichtum der Kompagnie demonstrieren.
In den Straßen drängten sich Holländer, Chinesen, Malaien,
Neger, Inder und Mischlinge aller Rassen. Es gab Sklaven aus dem gesamten
Archipel, aus Bali, Amboina, Macassar, Borneo und Sumatra, dazu solche
aus Bengalen, Ceylon und Madagaskar. Jeder Haushalt besaß Sklaven,
ein einfacher Handwerker manchmal nur ein halbes Dutzend und die Räte
von Indien mehrere hundert. Durch die Menge schoben sich Lastenträger,
Sänften, von Wasserbüffeln gezogene Karren und manchmal ein Elefant.
In den Kontoren und Lagerhäusern stapelten sich Baumwoll- und Leinenstoffe
aus Indien, seidene Tücher aus Persien, Bengalen und China, Zinn aus
Malaysia, chinesisches Porzellan, Tee, Opium, Salpeter, Zucker, Ebenholz
und all die Gewürze Ostasiens: Muskatblüten und -Nüsse,
weißer und schwarzer Pfeffer, Zimt und die heiß begehrten Gewürznelken
von den Molukken. Die Gärten, Marktstände, Buden und Garküchen
waren voll von exotischen Blüten, Früchten, Gerüchen und
Menschen, von denen man in Europa keinerlei Vorstellung hatte.
Die Neuankömmlinge waren überwältigt. Das Staunen begann
gleich mit der Ankunft, wenn zahllose kleine Boote die Schiffe umschwärmten
und den Ausgezehrten exotische Früchte und Speisen verkauften. Fast
alle Berichterstatter machten sich die Mühe die verschiedenen Früchte
zu beschreiben: Ananas, Melonen, Bananen, Papayas, Mangos und Pampelmusen.
In der Stadt beglotzten sie die tausend Völkerschaften in ihren fremdartigen
Kleidern, Chinesen mit langen Seidenhemden und Pantoffeln, Inder mit geölten
Haaren, schwarze Sklaven, einheimische, mit Federn geschmückt Söldner
mit bunt bemalten Schilden, seltsamen Waffen und Musikinstrumenten, Frauen
in durchsichtigen Leibchen und Saris. Sie besuchten chinesische und malaiische
Hochzeiten, blumengeschmückte Prozessionen mit riesigen Pauken, chinesische
Theateraufführungen und Hahnenkämpfe. Fast jeder bewunderte die
Anmut und den reichen Schmuck der einheimischen Tänzerinnen. Einer
schreibt begeistert über die fremden Sitten und Gebräuchen und
der Schönheit der Stadt, wo sogar die Bastionen mit Magnolien und
Limonen bepflanzt waren. Er beteiligte sich an Jagden auf Krokodile, Nashörner,
Tiger und Büffel. Ein anderer fraß einmal so viele Mangos bis
ihm schlecht wurde. Andere sahen Elefantenjagden auf Ceylon. Wer hatte
im Europa des 17. Jahrhunderts schon jemals solche Tiere gesehen? In Batavia
und Colombo mußten die Söldner vor Elefanten exerzieren, damit
diese ihre Scheu vor dem Musketenfeuer verloren.
Natürlich hatte die VOC ihre Söldner nicht als bezahlte Touristen
geworben, aber große Kriege waren in Ostindien relativ selten. Die
Kolonialmächte vermieden nach Möglichkeit Konflikte mit mächtigen
Herrschern, schützten ihre Handelsniederlassungen mit Garnisonen und
eroberten lediglich kleinere Inseln. Zur Sicherung der exorbitanten Gewinne
war eine Monopolstellung im Handel von zentraler Bedeutung. Dazu jagte
man zwar auch die Schiffe der Konkurrenz, versuchte aber vor allem mit
den einheimischen Fürsten entsprechende Verträge zu schließen.
Wenn das Erscheinen der Flotte nicht ausreichte einen Fürsten zur
Unterschrift zu bewegen, landeten die Söldner und sorgten mit gezieltem
Terror für die notwendige Einsicht.
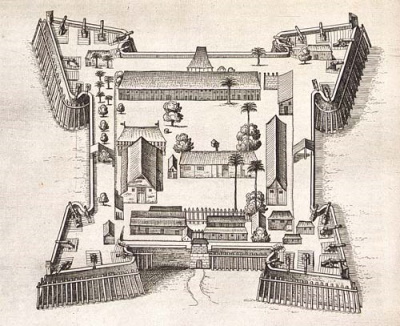 Oft rebellierten die Eingeborenen, wenn die Flotte weg war. Aber die
modernen Forts mit ihren Geschützen konnten sie nicht erobern, und
die Aufstände wurden wieder mit der altbewährten Brutalität
niedergeschlagen. Letzten Endes fügten sie sich und lieferten ihre
Gewürze in den Kontoren der VOC ab. Für Schwierigkeiten sorgten
lediglich englische Schiffe, die die Eingeborenen aufwiegelten und mit
Musketen versorgten, um ebenfalls an die begehrten Gewürze zu kommen.
Doch die Fregatten und Landungstruppen der VOC wurden meistens schnell
mit diesen Unruhen fertig. Die Söldner brannten einige Dörfer
und Felder nieder und versorgten den Sklavenmarkt in Batavia mit neuem
Nachschub. Bis Mitte des Jahrhunderts hatten sie die Inseln des Archipels
so dauerhaft "befriedet", daß viele ihre gesamte Dienstzeit ruhig
in den Garnisonen verbringen konnten.
Oft rebellierten die Eingeborenen, wenn die Flotte weg war. Aber die
modernen Forts mit ihren Geschützen konnten sie nicht erobern, und
die Aufstände wurden wieder mit der altbewährten Brutalität
niedergeschlagen. Letzten Endes fügten sie sich und lieferten ihre
Gewürze in den Kontoren der VOC ab. Für Schwierigkeiten sorgten
lediglich englische Schiffe, die die Eingeborenen aufwiegelten und mit
Musketen versorgten, um ebenfalls an die begehrten Gewürze zu kommen.
Doch die Fregatten und Landungstruppen der VOC wurden meistens schnell
mit diesen Unruhen fertig. Die Söldner brannten einige Dörfer
und Felder nieder und versorgten den Sklavenmarkt in Batavia mit neuem
Nachschub. Bis Mitte des Jahrhunderts hatten sie die Inseln des Archipels
so dauerhaft "befriedet", daß viele ihre gesamte Dienstzeit ruhig
in den Garnisonen verbringen konnten.
Doch das Leben in den kleinen weit verstreuten Forts hatte andere Tücken.
Viele Inseln waren als Fieberhöllen gefürchtet. Hinzu kam, daß
auch hier immer wieder einige Kommandanten die Gelegenheit nützten,
sich an der Nahrung zu bereichern. Aber fast noch schlimmer als die Krankheiten
war die im wahrsten Sinne des Wortes tödliche Langeweile. Die Söldner
bekämpften sie mit ihren altbewährten Mitteln: Suff, Spiel und
Streit. Es war sicher nicht ganz so übel wie auf den Schiffen, aber
im Laufe der Jahre kam einiges zusammen. Duelle, Messerstechereien, Totschlag
und die folgenden Strafen forderten meistens mehr Opfer als Kriege und
Strafexpeditionen. Wurffbain war fünf Jahre auf Amboina und dort geschah
einfach nichts. Er schreibt über Ruhr, Wassersucht, Fieber, Blattern,
Pocken und Beriberi und kam zu dem Schluß, daß auf Amboina
die ungesunde Luft mehr Europäer aufgerieben hätte, als die Waffen
der Eingeborenen. Die einzige Abwechslung scheinen Schiffe und Gerichtstage
gewesen zu sein. Die ersteren waren selten, die anderen eine regelmäßige
Abwechslung in der Monotonie. Akribisch notierte Wurffbain wieviele Personen
gegeißelt, gebrandmarkt, gewippt, verbannt, gerädert, gehängt,
enthauptet, stranguliert und erschossen wurden. Die Ursachen - Konspiration,
Gotteslästerung, Ehebruch, Blutschande, Mord, Totschlag, Desertion,
Sodomie und die Flucht von Sklaven - verraten viel über den Alltag in
einem kleinen Fort am Ende der Welt. Gewalt und die entsprechenden Strafen
findet man zwar in allen Reiseberichten, aber nur Wurffbain schreibt so
ausführlich darüber, da sich sonst auf Amboina absolut nichts
ereignete, was ihm berichtenswert schien. Klatschgeschichten, ein Dutzend
Schiffe, das Einfangen entlaufener Sklaven und alle ein, zwei Monate ein
Gerichtstag waren die Glanzlichter seines fünfjährigen Dienstes.
