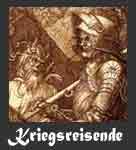Oberst Max Bauer
Ein Meister aus Deutschland
 Nicht selten lieben Söldner - und auch Soldaten - am Krieg besonders den Kampf, die Action, das
Adrenalin. Für viele ist diese Sucht nach starken Gefühlen sogar die Hauptmotivation diesen
Beruf auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die ganz kühl und berechnend
ihren "Job" ausüben. Man wird sie deshalb praktisch nie an vorderster Front antreffen, sondern
dort, wo der Tod organisiert wird, wo man plant und Strategien entwickelt. Es bestehen wohl kaum Zweifel,
dass es sich bei diesem Typus um den weitaus gefährlicheren handelt; allerdings zeigt er auch,
wo Söldner aus hoch entwickelten Industriestaaten - ganz anders als Adrenalinjunkies - heute noch
dringend gesucht werden.
Nicht selten lieben Söldner - und auch Soldaten - am Krieg besonders den Kampf, die Action, das
Adrenalin. Für viele ist diese Sucht nach starken Gefühlen sogar die Hauptmotivation diesen
Beruf auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die, die ganz kühl und berechnend
ihren "Job" ausüben. Man wird sie deshalb praktisch nie an vorderster Front antreffen, sondern
dort, wo der Tod organisiert wird, wo man plant und Strategien entwickelt. Es bestehen wohl kaum Zweifel,
dass es sich bei diesem Typus um den weitaus gefährlicheren handelt; allerdings zeigt er auch,
wo Söldner aus hoch entwickelten Industriestaaten - ganz anders als Adrenalinjunkies - heute noch
dringend gesucht werden.
Ein herausragendes Beispiel dieses Söldnertypus findet man in dem deutschen Generalstabsoffizier
Max Bauer. Im Unterschied zu fast allen deutschen Offizieren, die im Ersten Weltkrieg, im Generalstab
dienten, stammte Bauer aus bürgerlichen Verhältnissen und hatte seine Karriere nicht in einem
der traditionsreichen Gardekavallerieregimenter sondern wie viele Aufsteiger bei der Artillerie begonnen.
Anscheinend entsprach diese Tätigkeit seinen Neigungen, denn er kam rasch voran und wurde zum
maßgeblichen Spezialisten für schwere Festungsartillerie. Dabei ging es nicht darum, den
Einsatz einiger Geschütze zu leiten, viel mehr mussten neue Strategien geplant und mit den Großen
der Schwerindustrie Entwicklung und Produktion neuer Geschütze diskutiert werden.
In seiner Stellung war Bauer oft mehr Manager und Ingenieur als Offizier und hatte bald hervorragende
Beziehungen zur Rüstungsindustrie. Beim Ausbruch des Krieges wurde er dann in die OHL (Oberste
Heeresleitung) berufen. Als man dort nach den Materialschlachten des Jahres 1916 bemerkte, dass die
deutsche Industrie diesen Anforderungen nicht gewachsen war und für den totalen Krieg völlig
neu organisiert werden musste, schien Bauer der passende Mann für diese Aufgabe. Als Mann hinter
den Kulissen war er wesentlich an der Neuorganisation der Rüstungsindustrie in dem so genannten
Hindenburg-Programm verantwortlich. Man sollte jedoch anmerken, dass das Programm letzten Endes seine
Ziele nicht erreichte, da es wie alle planstaatlichen Versuche unter allzu viel Bürokratie und
Fehlplanungen litt. Dennoch wurde es bestimmend für Bauers Auffassungen von staatlichem Dirigismus
und seiner Selbstüberschätzung.
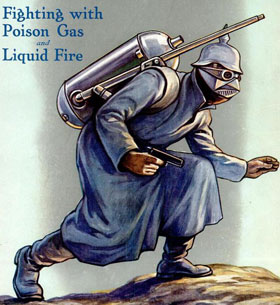 Durch seine enge Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie war Bauer auch entscheidend an der
Entwicklung neuer Waffen beteiligt. So kam unter seiner Regie der Flammenwerfer zum Einsatz, der schnell
als eine der furchtbarsten und schrecklichsten Waffen gefürchtet war. Wesentlich folgenreicher war
allerdings noch Bauers Zusammenarbeit mit dem deutschen Chemiker Fritz Haber. Sie führte zur
Entwicklung und schließlich zum Großeinsatz von Giftgas an der Front. Haber verwandte einige der dabei
gewonnenen Erkenntnisse anschließend bei der Schädlingsbekämpfung, einem Gebiet, auf dem auch
Bauer zu einem gefragten Spezialisten werden sollte. Der enge Zusammenhang beider Gebiete erscheint
nicht nur aus heutiger Sicht unmenschlich und widerlich; Habers Frau beging bereits 1915 Selbstmord,
nachdem alle ihre Einwände ignoriert worden waren. Der große Forscher selbst wurde zwar nach dem
Weltkrieg kurz als Kriegsverbrecher gesucht, dann aber doch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Durch seine enge Zusammenarbeit mit der Rüstungsindustrie war Bauer auch entscheidend an der
Entwicklung neuer Waffen beteiligt. So kam unter seiner Regie der Flammenwerfer zum Einsatz, der schnell
als eine der furchtbarsten und schrecklichsten Waffen gefürchtet war. Wesentlich folgenreicher war
allerdings noch Bauers Zusammenarbeit mit dem deutschen Chemiker Fritz Haber. Sie führte zur
Entwicklung und schließlich zum Großeinsatz von Giftgas an der Front. Haber verwandte einige der dabei
gewonnenen Erkenntnisse anschließend bei der Schädlingsbekämpfung, einem Gebiet, auf dem auch
Bauer zu einem gefragten Spezialisten werden sollte. Der enge Zusammenhang beider Gebiete erscheint
nicht nur aus heutiger Sicht unmenschlich und widerlich; Habers Frau beging bereits 1915 Selbstmord,
nachdem alle ihre Einwände ignoriert worden waren. Der große Forscher selbst wurde zwar nach dem
Weltkrieg kurz als Kriegsverbrecher gesucht, dann aber doch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Als der Krieg dann trotz Hindenburg-Programm und Giftgas verloren ging, wurde Bauer zu einem der führenden
Köpfe der radikalen Rechten, die den Sturz der neuen republikanischen Regierung planten. Während des
Kapp-Putsches 1920 war Bauer Leiter der Reichskanzlei und damit einer der wichtigsten Männer. Nach dem
Scheitern des Putsches musste er deshalb erst einmal nach österreich ins Exil gehen.
Im Gegensatz zu vielen eher monarchistisch gesinnten Offizieren, die vor allem in der Reichswehr den
Ton angaben, zählte Bauer zur so genannten "Konservativen Revolution", einer sehr vielschichtigen
Bewegung, die zwar Demokratie und Liberalismus vehement ablehnte, an der Restauration der Monarchie aber
kein Interesse hatte. Tief beeindruckt von der Dynamik der russischen Revolution und den Möglichkeiten
des Industriezeitalters plante man eine populistische Diktatur mit staatlicher Lenkung der Industrie,
wofür Bauer durch seine Stellung der der OHL ja die besten Voraussetzungen mitbrachte.
Durch diese Zugehörigkeit zur revolutionären Rechten, ergaben sich schließlich Verbindungen
zu Sowjetrussland. Dies war sicher ungewöhnlich, aber hier wie dort sah man zumindest manchmal in den
westlichen Demokratien den Hauptgegner und war auf der Suche nach neuen Verbündeten. Für Bauer war
sicher ausschlaggebend, dass er in österreich in recht bescheidenen Verhältnissen lebte und sich
recht erfolglos mit weißrussischen Emigranten an einigen Verschwörungen und Umsturzplänen in
Osteuropa beteiligt hatte, wovon sein Mitarbeiter Trebitsch-Lincoln die Weltöffentlichkeit unterrichtete.
Er muss sich ein wenig wie der Prophet in der Wüste gefühlt haben, und war also nicht wenig
geschmeichelt als eine sowjetische Militärzeitschrift einige Aufsätze von ihm - darunter einen
zum Gaskrieg - abdruckte.
Damit nicht genug folgte dann auch noch eine Einladung von Trotzki persönlich, in der Bauer aufgefordert
wurde die Sowjetunion kennenzulernen. Es ist bis heute unklar, ob die Sowjets Bauer als Spezialisten anheuern
wollten oder durch ihn nur engeren Kontakt zur deutschen Rechten und der Großindustrie suchten. Bauer
ließ sich nicht lange bitten und reiste Ende 1923 nach Moskau. Dort traf er einige bedeutende
Persönlichkeiten, darunter auch Trotzki, den er überschwänglich als "geborenen militärischen
Organisator und Führer" lobte. Außerdem schwärmte er von den Möglichkeiten, die sich der
deutschen Industrie böten. Gerade hier wird deutlich, wo die größten Verdienstmöglichkeiten
für Militärberater lagen. Bei der Vermittlung von Verträgen wurden immer Prämien bezahlt,
die leicht ein Vielfaches eines Beratergehalts betragen konnten. Es ist gut möglich, dass Bauer hier einiges
verdient hat, auch wenn es zu keinem Beschäftigungsverhältnis mit den Sowjets gekommen ist.
Er musste sich allerdings keine großen Sorgen machen, denn bald nach seiner Rückkehr erhielt er ein
Angebot der spanischen Regierung, als Militärberater in ihre Dienste zu treten. Den Kontakt hatte
wahrscheinlich Hugo Stoltzenberg vermittelt. Stoltzenberg war Chemiker hatte bereits im Ersten Weltkrieg mit
Haber an der Entwicklung von Chlor- und Senfgas gearbeitet und war dabei natürlich auch in engstem Kontakt
mit Bauer gestanden. Da dem Deutschen Reich durch den Friedensvertrag von Versailles die Produktion von Giftgas
untersagt war, hatte Stoltzenberg in Hamburg eine Firma zur Vernichtung von chemischen Kampfstoffen gegründet.
Dies war allerdings reine Fassade, denn in der "Chemischen Fabrik Stoltzenberg" wurde mit heimlicher
Unterstützung der Reichswehr weiterhin geforscht und die notwendigen Grundstoffe produziert.
Als nun das spanische Heer bei dem Versuch die Besitzungen in Nordmarokko auszudehnen 1921 bei Annual
vernichtend geschlagen wurde, begannen sich die Generäle nach neuen Methoden der Kolonialkriegsführung
umzusehen. Dabei stießen sie auf Stoltzenberg, dessen Firma bald in großem Umfang damit begann die notwendigen
Chemikalien zu liefern. Zu deren Verarbeitung wurden unter Stoltzenbergs Leitung dann zwei Giftgasfabriken
bei Madrid und eine bei Melilla im Norden Marokkos errichtet. Nachdem die Produktion erfolgreich angelaufen
war, benötigte man natürlich noch einen erfahrenen Strategen für den konkreten Einsatz, und
hier kam Bauer ins Spiel.
 Bauer unterhielt ein kleines Büro in Madrid, in dem er Studien zur Reform des Heeres und der Rüstungsindustrie
erarbeitete. Schwerpunkte waren dabei die Modernisierung der Artillerie und des Flugzeugbaus. Während er für
die Artillerie selbst Konstruktionspläne entwarf, arbeitete im Bereich Flugzeuge eng mit der Firma Junkers zusammen,
die ihn für seine Tätigkeiten mit 500 Reichsmark Spesen entschädigte. Beide Waffensysteme waren für
den Einsatz von Giftgas geeignet und so entwickelte er gemeinsam mit Stoltzenberg Gasgranaten und Bomben. Nebenbei ergab
sich sogar die Gelegenheit, die zivile Nutzung dieser Technik vorzuführen. Anlässlich eines
Heuschreckeneinfalls in Südspanien entwickelte er eine Strategie um Heuschrecken mit Giftgas zu bekämpfen,
für einen Krieger seines Schlages spielte es ja sicher keine große Rolle, ob man Insekten oder feindliche
Soldaten vernichtete.
Bauer unterhielt ein kleines Büro in Madrid, in dem er Studien zur Reform des Heeres und der Rüstungsindustrie
erarbeitete. Schwerpunkte waren dabei die Modernisierung der Artillerie und des Flugzeugbaus. Während er für
die Artillerie selbst Konstruktionspläne entwarf, arbeitete im Bereich Flugzeuge eng mit der Firma Junkers zusammen,
die ihn für seine Tätigkeiten mit 500 Reichsmark Spesen entschädigte. Beide Waffensysteme waren für
den Einsatz von Giftgas geeignet und so entwickelte er gemeinsam mit Stoltzenberg Gasgranaten und Bomben. Nebenbei ergab
sich sogar die Gelegenheit, die zivile Nutzung dieser Technik vorzuführen. Anlässlich eines
Heuschreckeneinfalls in Südspanien entwickelte er eine Strategie um Heuschrecken mit Giftgas zu bekämpfen,
für einen Krieger seines Schlages spielte es ja sicher keine große Rolle, ob man Insekten oder feindliche
Soldaten vernichtete.
Angeblich war der argentinische Militärattaché von dem Vortrag so beeindruckt, dass er Bauer im Namen
des argentinischen Landwirtschaftsministeriums einlud, um in Argentinien über moderne Methoden
der Schädlingsbekämpfung zu referieren. Man kann dies jedoch für eine vorgeschobene Nebentätigkeit
halten, um den schönen Schein zu wahren. Bauer, dessen Vertrag mit der spanischen Regierung im Sommer 1925
ausgelaufen war, arbeitete bei seinem anschließenden Argentinienaufenthalt zwar an der
Schädlingsbekämpfung, erstellte aber auch Studien zur Neuorganisation und Bewaffnung des argentinischen
Heeres. Dabei kamen ihm alte Kontakte zu dem dort tätigen deutschen Militärberater Wilhelm Faupel, den
er aus dem Generalstab im Ersten Weltkrieg kannte, zugute.
Während Bauer noch in Argentinien arbeitete, begann die spanische Armee unter Stoltzenbergs Leitung mit dem
Einsatz von Giftgas in Marokko; man kann annehmen, dass Bauer an der Entwicklung der angewandten Strategie
entscheidend beteiligt gewesen war. Dabei wurde das Gas weniger direkt an der Front eingesetzt, sondern Märkte,
Oasen und Dörfer im Hinterland bombardiert. Da Senfgas auch über die Haut aufgenommen wird, wobei es zu
entsetzlichen Geschwüren kommt, richteten sich diese Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, die sich beim
Kontakt mit Wasser und Pflanzen vergiftete.
Der Einsatz wurde seinerzeit weitgehend geheim gehalten. Im Genfer Protokoll wurde 1925 zwar die Anwendung
von Giftgasen ausdrücklich verboten, in den Kolonien interessierte dies jedoch wenig, weshalb auch
Italien in äthiopien 1935/36 Giftgasbomben in großem Stil einsetzte. Da sich auch Frankreich inzwischen
am Krieg gegen die Rifkabylen unter Abdelkrim beteiligte, hatte praktisch niemand Interesse daran die spanischen
Kriegsverbrechen und die deutsche Schützenhilfe aufzudecken.
Bauer konnte aber von diesen Erfolgen nicht profitieren; er war nach seiner Rückkehr aus Argentinien erst
einmal arbeitslos. Auf der Suche nach neuen Einkommensquellen pflegte er einerseits die Verbindungen zu
Waffenfabrikanten in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden; andererseits verfasste er militärtechnische
Denkschriften und Studien - u.a. für die Türkei -, die natürlich auch dazu dienten, die Produkte der
Rüstungsindustrie an den Mann zu bringen. Er versuchte also als Waffenlobbyist ins Geschäft zu kommen. Ohne
feste Stelle und den damit verbundenen Einfluss war dies allerdings schwierig.
Es wird keine gute Zeit für ihn gewesen sein. Er war zwar 1925 amnestiert worden, seine etablierten Kameraden
bei der Reichswehr mieden aber den Umgang mit ihm. Die Republik hatte sich wirtschaftlich stabilisiert, wodurch die
radikale Rechte und damit auch Bauer gewaltig an Einfluss verloren. Möglicherweise ließen ihm seine
Bekannten aus der Rüstungsindustrie manchmal etwas zukommen. Dennoch waren die Aussichten düster.
 Die Rettung kam in Form einer chinesischen Delegation, die sich bei Ludendorff nach einem geeigneten Offizier für
die Modernisierung des chinesischen Heeres erkundigten. Bauer war bereits 1923 über seinen alten Freund
Trebitsch-Lincoln, der sich nach China abgesetzt hatte, mit einem chinesischen Warlord in Kontakt gekommen. Allerdings
war dieser gestürzt worden, bevor es zu konkreten Vereinbarungen kam. Als nun die Vertreter der Kuomintang-Regierung
auf Empfehlung Ludendorffs bei ihm anfragten, war er schnell bereit nach China zu reisen, um sich vor Ort ein genaueres
Bild zu machen.
Die Rettung kam in Form einer chinesischen Delegation, die sich bei Ludendorff nach einem geeigneten Offizier für
die Modernisierung des chinesischen Heeres erkundigten. Bauer war bereits 1923 über seinen alten Freund
Trebitsch-Lincoln, der sich nach China abgesetzt hatte, mit einem chinesischen Warlord in Kontakt gekommen. Allerdings
war dieser gestürzt worden, bevor es zu konkreten Vereinbarungen kam. Als nun die Vertreter der Kuomintang-Regierung
auf Empfehlung Ludendorffs bei ihm anfragten, war er schnell bereit nach China zu reisen, um sich vor Ort ein genaueres
Bild zu machen.
In China hatte die Kuomintang zuerst im Bündnis mit den Kommunisten die unabhängig in den Provinzen
herrschenden Warlords bekämpft. Nachdem diese weitgehend besiegt waren, waren die Truppen der Kuomintang
über die Kommunisten hergefallen und kontrollierten nun einen Großteil des Landes. Bei den dringend
notwendigen Reformen von Wirtschaft und Militär hatten bislang auf sowjetische Berater geholfen, da die
Kolonialmächte England und Frankreich als Bedrohung empfunden wurden. Als dann mit dem Kampf gegen die
chinesischen Kommunisten die sowjetischen Berater China verlassen mussten, war die Zeit für die Deutschen
besonders günstig.
Dennoch schien Bauers Tätigkeit erst einmal unter keinem guten Stern zu stehen. Denn kaum war er im
November 1927 in Kanton angekommen, als die Regierung vor einem putschenden General flüchten musste.
Kurz darauf versuchten die Kommunisten erfolglos die Macht zu übernehmen, und Bauer fehlte in dem
Chaos über Wochen jeder Ansprechpartner. Die änderte sich erst, als er zum Jahresende nach Shanghai
kam und dort General Chiang Kai-shek, dem neuen Führer der Kuomintang, vorgestellt wurde. Sie scheinen
sich von Anfang an verstanden und geschätzt zu haben. Beide waren erfahrene Offiziere, die in die
Politik eingegriffen hatten; sowohl strikte Antikommunisten wie auch Feinde von Liberalismus und
parlamentarischer Demokratie westlicher Prägung.
Damit stand Bauer zwar erst am Anfang einer gigantischen Aufgabe, er konnte sich aber der vollen
Unterstützung des Generals sicher sein. Es war eine Tätigkeit, die ganz seinen Ambitionen entsprach.
Er musste sich nicht nur auf das Militär beschränken, sondern konnte auch für Wirtschaft, Industrie,
Infrastruktur und Städtebau planen. Natürlich konnte er nicht entscheiden, sondern nur Vorschläge
erarbeiten, doch er als alter politischer Verschwörer liebte er Visionen, von denen er einige in China
realisieren wollte. Er schwärmte bereits von einem Bündnis Chinas mit der Türkei als Basis einer
gigantischen Allianz der "unterdrückten Völker" - wozu natürlich auch Deutschland gehörte -
gegen die Versailler Siegermächte.
 Zuerst unternahm er mit einem Dolmetscher einige Reisen in Südchina um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen, dann eröffnete er ein Büro in Nanking, von dem aus er seine Arbeit leiten wollte. Anschließend begab er sich mit einer chinesischen Kommission auf eine Europareise, um dort Kontakte zur Industrie zu knüpfen aber auch dringend notwendiges Fachpersonal anzuwerben. Obwohl sich seine Tätigkeit zwar auf Deutschland konzentrierte, bereiste er auch österreich, die Schweiz und die Niederlande, wo er ebenfalls hervorragende Kontakte zur Industrie hatte. Neben ehemaligen Militärs warb er Ingenieure, ökonomen, Verwaltungsfachleute und Mediziner. Insgesamt soll er über 50 Fachleute angeworben haben, von denen später aber nicht alle in China eintrafen. Mit der Industrie verhandelte er über die Lieferung von Maschinen, Fahrzeugen aber auch ganzer Produktionsanlagen.
Zuerst unternahm er mit einem Dolmetscher einige Reisen in Südchina um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen, dann eröffnete er ein Büro in Nanking, von dem aus er seine Arbeit leiten wollte. Anschließend begab er sich mit einer chinesischen Kommission auf eine Europareise, um dort Kontakte zur Industrie zu knüpfen aber auch dringend notwendiges Fachpersonal anzuwerben. Obwohl sich seine Tätigkeit zwar auf Deutschland konzentrierte, bereiste er auch österreich, die Schweiz und die Niederlande, wo er ebenfalls hervorragende Kontakte zur Industrie hatte. Neben ehemaligen Militärs warb er Ingenieure, ökonomen, Verwaltungsfachleute und Mediziner. Insgesamt soll er über 50 Fachleute angeworben haben, von denen später aber nicht alle in China eintrafen. Mit der Industrie verhandelte er über die Lieferung von Maschinen, Fahrzeugen aber auch ganzer Produktionsanlagen.
Auch wenn es bei vielen dieser Projekte nie über die Planung hinauskam, so war doch verständlich, dass allein die gewaltigen Möglichkeiten, die der chinesische Markt bot, den Neid der anderen Industrienationen hervorrufen musste. Da Deutschland im Versailler Vertrag auch die Stellung von Militärberatern untersagt war, distanzierte sich die Reichsregierung ganz offiziell von ihm und seinen Tätigkeiten. Er selbst erklärte, gar nicht im Dienst der chinesischen Regierung zu stehen, sondern lediglich als Vertreter der deutschen Industrie tätig zu sein. Damit hatte er auch nicht ganz unrecht, denn auch wenn man in Deutschland seine Geschäfte mit großem Wohlwollen beobachtete, so konnte er doch mit keiner diplomatischen Rückendeckung rechnen.
Die größte Gefahr für seine hoch fliegenden Pläne war er jedoch wahrscheinlich selbst. Wie schon während seiner Tätigkeit beim Hindenburg-Programm war er viel zu sehr in planstaatlichen technokratischen Ideen, verfangen, als dass er sich mit dem Machbaren hätte zufrieden gegen können. "Ihm fehlte das gesunde Augenmaß für eine realistische Einschätzung", stellte der Historiker Adolf Vogt fest. Für Bauer war es nicht verständlich, dass die deutschen Industriellen erst einmal nach dem Gewinn fragten, während er schon eine neue Weltordnung heraufdämmern sah.
Der wirtschaftliche Aufbau Chinas wurde für ihn zu seinem wichtigsten Anliegen. Als Chiang Kai-shek Anfang 1929 gegen einige rebellische Generäle vorgehen wollte, widersetzte sich Bauer energisch diesen Plänen, da er in inneren Kriegen ein Haupthindernis für die dringend benötigten ausländischen Investitionen sah. Erst als Chiang Kai-shek auf dem Feldzug bestand, entwarf Bauer widerwillig den Operationsplan. Diesen scheint er dann jedoch äußerst gekonnt umgesetzt zu haben, denn der Korrespondent der Times berichtete, dass der Feldzug die Schule des preußischen Generalstabs erkennen lasse.
 Da er ja offiziell kein Berater war, begleitete Bauer die Truppen als Kriegsberichterstatter. Nach wenigen Wochen
war der Feldzug siegreich abgeschlossen. Bauer konnte sich des Erfolges jedoch nicht mehr erfreuen, da er sich an
den Pocken infiziert hatte, an denen er wenige Wochen später starb. Nach seinem Tod kehrten zwar die meisten
der zivilen Berater, die er ins Land geholt hatte, zurück, die Militärs jedoch blieben, da Chiang Kai-shek
vor allen an ihren Diensten gelegen war.
Da er ja offiziell kein Berater war, begleitete Bauer die Truppen als Kriegsberichterstatter. Nach wenigen Wochen
war der Feldzug siegreich abgeschlossen. Bauer konnte sich des Erfolges jedoch nicht mehr erfreuen, da er sich an
den Pocken infiziert hatte, an denen er wenige Wochen später starb. Nach seinem Tod kehrten zwar die meisten
der zivilen Berater, die er ins Land geholt hatte, zurück, die Militärs jedoch blieben, da Chiang Kai-shek
vor allen an ihren Diensten gelegen war.
Unter Bauers Nachfolgern General Georg Wetzell (1930-1934), Generaloberst Hans von Seeckt (1934-1935) und
General Alexander von Falkenhausen (1935-1938) wurden mehrere chinesische Divisionen nach deutschen Vorbild
ausgebildet und ausgerüstet. Allerdings wurden diese Musterdivisionen dann 1937 bei den blutigen
Kämpfen um Shanghai zum Großteil aufgerieben. Danach wurden die deutschen Militärberater abgezogen,
da sich Hitler für ein Bündnis mit Japan entschlossen hatte. Lediglich einige wenige wie der
SA-Führer Walther Stennes, die in Deutschland um ihr Leben fürchten mussten, blieben als Emigranten
weiterhin im Dienste Chiang Kai-sheks.